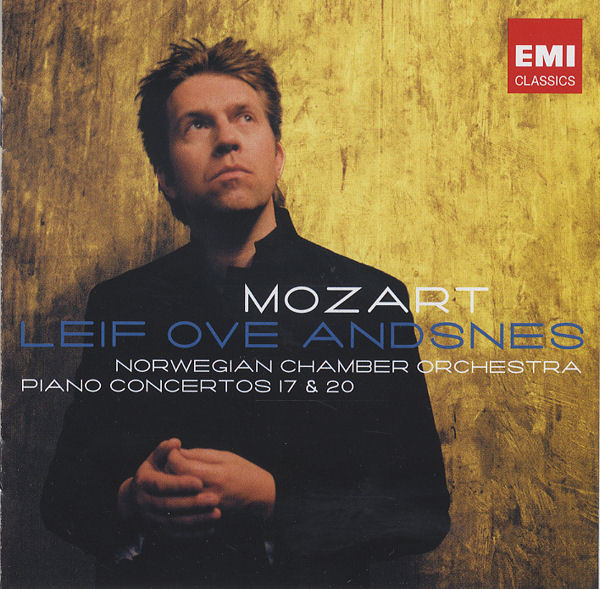"Ich vermute stark, dass 250 Jahre Hörgewohnheiten sich über diese Musik gelegt haben und Interpretationen, die auf historischen Fakten beruhen, daran gemessen werden." (moderato) Eine allgemein formulierte Vermutung ist keine persönliche Unterstellung.
Lieber moderato,
natürlich nicht. Grundsätzlich gehe ich erst einmal davon aus, dass wir hier nicht dumm genug sind, uns auf die niedere Ebene persönlicher Unterstellungen oder gar persönlicher Angriffe herabzulassen. Den Widerspruch gegen eine vertretene Meinung werte ich grundsätzlich und zunächst nur als "Infragestellung" eines Inhalts, den das "literarischen Ich" eines Diskussionsteilnehmers veröffentlichte.
In Deiner Argumentation sehe ich einen Punkt, bei dem ich mich frage, ob das nicht ein Denkfehler sein könnte: "....Interpretationen, die auf historischen Fakten beruhen..."
Das würde ja heißen, dass die "historischen Fakten" einen engen Rahmen vorgäben, innerhalb dessen man noch ein wenig Interpretation braucht, aber natürlich "entlang der üblichen aufführungspraktischen Regeln". Man kann also minimal noch etwas am Tempo machen ( es gibt ja auch die Ansicht, dass man z.B. bei Beethoven einfach nur das Metronom anschalten müsse etc.); und man kann ein bisschen an der Dynamik (wird durch die Partitur und die alten Regeln schon vorbestimmt) und an der Artikulation arbeiten ( auch hier geben die Partitur und die alten Regeln einen engen Rahmen vor). Viel mehr an Interpretation bräuchte man dann nicht, wenn man nur gut genug die Fakten recherchiert hätte. Hielten sich alle an die alten Regeln und würden alle Interpretationen auf historischen Fakten beruhen, dann könnte man aufnahmetechnische Unterschiede ausmachen, ansonsten klänge alles sehr ähnlich. Tatsächlich klingen Schoonderwoerds Aufnahmen auch in dieser Richtung. Hast du so ein Klavierkonzert in diesem Stil gehört, hast du damit irgendwie auch alle gehört.
Und bis wohin ist es sinnvoll, so eine - wie ich finde- außermusikalische "auf Fakten beruhende" Denkweise überhaupt im Bereich der Musik anwenden?
Ein Beispiel:
Die Musik, die ich selbst schreibe, war und ist zunächst einmal für mich selbst gedacht. Ich brauchte z.B. alternative Orgelsätze für Choräle, Orgelstücke, die während der Kommunion gespielt wird oder sehr oft auch ein Präludium bzw. ein Postludium. Nun ist es schon vorgekommen, dass andere Organisten diese meine Musik spielten, weil ich z.B. als Teilnehmer einer Beerdigungsfeier nicht selbst an der Orgel sitzen konnte. Es klang dann immer sehr anders als das, was ich mir eigentlich vorstellte, und das Ergebnis war vor allem sehr abhängig von der Musikalität des Ausführenden, obwohl ich eigentlich meine, recht ordentlich und klar notiert zu haben (mit Cubase, nicht per Hand...)
Aber ich machte auch andere, bessere Erfahrungen: für eine Beerdigung schrieb ich für eine Cellistin, die im Orchester "Oslo Philharmonie" arbeitet, einige Cellostimmen zur Orgel, in diesem Fall im barocken Stil. Wir hatten keine Zeit zum Proben, aber sie erkannte per sofort, was ich meinte, ohne dass ich Ausführungsanweisungen in die Noten schrieb, ja, ich möchte behaupten, sie übertraf sogar meine Erwartungen und Vorstellung dahingehend, wie man diese Gegenstimmen zum Cantus Firmus gut und schön spielen könne. Die Zusammenarbeit mit Profis kann so leicht und entspannend sein, verglichen mit dem täglichen Brot, dass der Kirchenmusiker meistens mit Amateuren arbeiten muss. Doch das nur nebenbei...
Ein ähnliches Erlebnis hatte ich bei einer CD-Aufnahme, bei der auch wieder Musiker desselben guten Orchesters mitwirkten. Dort spielte ich auf dem Flügel, und der Flötist, mit dem ich aufgrund des engen Aufnahmeplans nicht ein Wort wechseln konnte, verstand sofort die Absicht und den Sinn meiner in den Noten nicht eingezeichneten "agogischen Maßnahmen" wie z.B. eine Hauptnote etwas länger zu Lasten der folgenden Noten zu spielen, um einen Betonung im Sinne einer bewegten Gestik zu erzielen. Wir waren da sofort zusammen, nicht nur handwerklich, sondern auch "vom Geiste" her.
Warum erzähle ich das? Weil es Beispiele von vielen sind, in denen ohne Umwege in Musik entweder gut oder weniger gut mitgedacht, empfunden und ausgeführt wurde. Aus der Musik selbst ergeben sich bei entsprechenden Fähigkeiten und einem gereiften Geschmack bestimmte musikalische Entscheidungen, insbesondere dann, wenn es um die Expressivität geht. Es gibt da kein "faktisches" Fazit. Selbst meine eigenen Noten spiele ich jeden Tag anders. Wäre es anders, dann würde man die Musik auf das Faktische reduzieren, all das Transzendente, das Elegante, das Traurige, das Erhabene....das könnte man gleich vernachlässigen, denn man hat ja die Noten und die jeweiligen Fakten zu den ermittelten Aufführungsumständen.
Wenn ich den Ausdruck "beruht auf Fakten" höre, dann hat das etwas von "so ist es, und nicht anders - das sind die Fakten, gewöhne dich daran". Diese Fakten wurden aber nicht musikalisch, sondern außermusikalisch "ermittelt".
Ich kenne auch diese Meinung gegen das "Interpretieren" in der Musik an sich. Sigisvald Kuijken etwa findet, dass man Bach nur spielen müssen, nicht interpretieren. So klingt es auch: ein sehr kleiner dynamischer Umfang, mittlere Tempi, faktische Klarheit und Transparenz ....und sonst dann eher nichts. Die Musik an sich als nüchterne Darstellung des Faktischen.
Auch Celibidache meinte (in seinem egomanischen Größenwahn, den er anderen, wie z.B. Karajan gerne vorwarf), dass er nicht interpretiere. Die Musik sei eine Landschaft, durch die man mit dem Zug hindurchführe. Sie wäre eben das, was sie ist, nicht das, was man interpretiert.
Seine Ergebnisse indes kann man durchaus als genial-subjektiv bewerten, wie ich finde.
Wenn das, was aus den Lautsprechern klingt oder im Konzert erlebt werden kann, nicht überzeugen sollte, hat dies mit unseren Hörgewohnheiten zu tun.
Ja und nein. Ja, weil es natürlich ungewohnt klingt - ok, einverstanden.
Nein, weil es musikalisch (aus der Musik heraus) einfach nicht überzeugend klingt. Hier geht es um mehr als um Gewohnheiten. Hier geht es um das, was die Musik tatsächlich sein möchte, sein kann. Sie besteht aus Melodien, Harmonien und Rhythmen, die in ihrer eigenen musiksprachlichen Welt einen jeweiligen Sinn ergeben können. Gute Musik kann in komprimierter Form nahezu alles zum Ausdruck bringen (Expressivität!) was es so im "normalen Leben" gibt, z.B: Enttäuschung, freudige Überraschung, Trost, Unterhaltung, Resignation, Entsetzen oder - wie manchmal bei Brahms- so ein Gefühl von "lush" wie die Amerikaner sagen, will sagen: aus der Perspektive eines gereiften Menschen, zieht das Leben vorbei. Vor sich hat er den Tod, hinter sich die wehmütigen Erinnerungen.....Das hat etwas von "ich bin der Welt abhanden gekommen..."
Auch "schauderlich" im rechten Sinne kann eine gute Musik klingen, wie etwa bei Schuberts Winterreise.
Die Schoonderwoerd-Darstellung auf dem Hammerflügel finde ich zwar auch schauerlich, aber nicht, weil mich da die Musik in diesen Gefühlszustand versetzen kann, sondern weil sein Spiel und vor allem sein Instrument so klingt.
Ich bin kein Streaming-Experte, ich weiss daher nicht, ob die von Schoonderwoerd verfassten Bookletexte zur Verfügung stehen, wenn man die Musik herunterlädt. Weil ich Schoonderwoerds Aufnahmen in meiner Sammlung im CD-Format vorliegen, kann ich Schoonderwoerds Begründungen nachlesen, weshalb er und seine Mitmusiker so die Musik interpretieren, wie sie aus den Lautsprechern klingt. Die Argumente für die von ihm vertretene Aufführungspraxis überzeugen mich.
Nein, die Booklets kann man z.B. auf TIDAL nicht digital einsehen.
Selbst die beste verbale Argumentation über die Musik kann mich nicht überzeugen, wenn die Musik aus sich selbst heraus einfach nicht überzeugen kann. Und hier wieder die Klarstellung: Das hat sehr viel mehr etwas mit innermusikalischen Parametern zu tun, als mit "eingefahrenen Hörgewohnheiten".
Dass heutzutage niemand die Furtwänglerische Aufführungspraxis der Matthäus-Passion mit dem Continuo-Flügel, Massenbesetzung, Sostenuto-Stil usw. oder die Bachsche Cembalomusik mit Karl Richters Ungetüm (welches man Cembalo nannte) wieder aufgreift, hat einen einfachen und plausiblen Grund: es klingt einfach musikalisch sehr sehr viel überzeugender, wenn man sich da etwa die entsprechenden Harnoncourt-Aufnahmen oder Leonhardts Cembalospiel anhört. Das sind es dann nicht Booklet-Texte oder sonstige Bücher, die dafür sorgten, dass sich ein anderer grundsätzlicher Ansatz bei der Barockinterpretation durchsetzte. Eben weil es musikalisch einfach nachvollziehbarer klingt, hat es sich durchgesetzt, sowohl bei Musikern als auch bei den Hörern. Am Ende waren die Meisten bereit, ihre "alten Hörgewohnheiten" zu Gunsten eines wesentlich überzeugenderen musikalischen Ansatzes abzulegen.
Hier bei Schoonderwoerd ist das aber nicht so.
Hier ein Text aus "Classical music", ins Deutsche übersetzt:
"Die Ergebnisse sind sicherlich ‘anders’, aber mit der Neuheit, die von ‘authentischen’ Aufführungen verschwunden ist, sind Schoonderwoerds Ergebnisse bestenfalls erfrischend, wenn Sie die Meisterwerke in Röntgenform mögen: Die Knochenstruktur wird klar, Fleisch und Persönlichkeit indes fehlen. Nichts, was diese tapferen Musiker tun, widerspricht den Markierungen in den Partituren, aber selbst wenn sie einen Stakkato-Angriff ausführen, erreicht der Effekt die beängstigende Kraft eines kläffenden Chihuahuas.
Drei Hörner sind in der Eroica-Symphonie erlaubt, zum Glück für das Trio des Scherzos; aber immer wieder geschieht es in diesem Album, dass die dünnen, kahlen Klangfarben darum kämpfen, irgendetwas von den Muskeln und vom Glanz dessen zu vermitteln, was in Beethovens geschriebenen Noten enthalten ist.
Beethoven musste bei der Premiere der Symphonie die bescheidenen Kräfte/Umstände in Prince Lobkowitz’ privatem Konzertsaal ertragen. Aber wollte er es wirklich so haben, dass (sein Werk) zu (bescheidenen) Kammermusik zurechtgestutzt wird? Die Zuhörer werden sicherlich ihre eigene Antwort auf diese Frage finden, eine Frage, die Schoonderwoerd, plodderisch ( langsam, ohne Inspiration, ohne Imagination) und kurzsichtig, nie zu stellen scheint."
Der Autor dieses Textes hat es in meinen Augen ganz gut zusammengefasst; die Passagen in Klammern sind meine Versuche, den englischen Text im Deutschen verständlich zu machen.
Zudem vermisse ich eine gewisse klangliche Ausgewogenheit im "Orchester".
Die Blech- und Holzbläser ergeben einen Sound im Sinne einer Harmonie-Musik, die dann noch von der Pauke und dem Streichquartett ergänzt, bzw. begleitet wird.
Für diese Musik ist es sicher falsch, alles nur von einem satten Streicherklang her hören zu wollen, aber ist diese Kammermusik, diese Bläserensemble plus Streichquartett wirklich in der Lage zu vermitteln, was die Musik Beethovens enthält? Nur sehr reduziert, wie ich finde.
...aber das Ergebnis ist eindeutig: Keine einzige dieser Ausgaben trägt die Singular-Bezeichnungen. Schoonderwoerd beruft sich also zwar auf eine existierende Quelle, schreibt dieser aber in der Frage der Streicher-Besetzung eine Bedeutung zu, die sie nach übereinstimmender Meinung der musikphilologischen Fachleute einfach nicht hat. Das ist typisch für Musiker, die im Gegensatz zu "reinen" Herausgebern bei der Quellenbewertung immer auch schon die praktischen Konsequenzen im Kopf haben. Dagegen spricht auch nichts, wenn man es gewissermaßen als Inspirationsquelle für seine persönliche Darstellung nimmt, aber es ist einfach wissenschaftlich unhaltbar, einer solchen Entscheidung eine allgemeinverbindliche Begründung geben zu wollen. Dass Schoonderwoerd die Eroica mit solistischen Streichern besetzt, hat nur einen Grund: Er will es so.
(Hervorhebung von mir)
Das sehe ich tatsächlich auch genau so. Er hat sich dann eben doch seine Aufführungspraxis "zurechtargumentiert" oder argumentativ "passend gemacht".
Meine Vermutung, warum er bzw. sein Label es so will: er hat sich damit im Markt eine Nische geschaffen. Das ist ja legitim, aber daraus dann so eine allgemeinverbindliche Aussage zu machen ( im Sinne von: so ist es faktisch richtig, ihr müsst nur eure tradierten Hörgewohnheiten ändern) schießt über das Ziel weit hinaus.
Das Ziel des Improvisierens, Komponierens und Interpretierens (Nach-Erschaffung) von Musik hat in meinen Augen immer in irgendeiner Form einen human-expressiven Charakter. Man befindet sich in einem gewissen Seelenzustand (kann sehr verschieden sein) und möchte das durch Musik zum Ausdruck bringen und Andere, die diese Schallwellen hören können, in eben diesen Seelenzustand mit hineinnehmen. Bei Schubert etwa kann das erschreckend sein, weil er (das empfinde ich z.B. subjektiv bei der Unvollendeten aber auch bei D.960) persönlichen Kindheitstraumata eine musikalische Stimme gibt. Ja, eine steile These, aber ich will, wenn es die Zeit erlaubt, einmal bei D. 960 versuchen, aus den Noten heraus eine mögliche Begründung zu liefern.
Bei diesem rekonstruktiven und "faktischen" Ansatz Schoonderwoerds kann man m.E. all diese Dinge gleich vergessen. "So ist die Musik, nicht anders, nicht mehr, nicht weniger - gewöhne dich daran und fertig". Das ist mir zu wenig, ja, ich finde es nicht musikalisch.
Musik als "Klangsprache" ist mir suspekt, sie war dazu gedacht, die Leute zu unterhalten und zu erfreuen, nicht zu "erschüttern" etc etc und was dergleichen Ansprüche das sind.
Keiner der adeligen Herren, für die im 18. und frühen 9. Jahrhunder Musik komponiert wurde, wollte erschüttert werden.
Da argumentierst Du aber sehr asymmetrisch, weil Du jetzt eigentlich Boccherini meinst oder die eher lieblichen Kompositionen Haydn oder Mozarts, wie ich annehme.
Beethovens Eroica will - so meine ich- durchaus erschüttern, nicht nur nett unterhalten.
Die "Klangrede" an sich geht auf die Zeit des Früh- und Hochbarock zurück und wurde von Mattheson als in seinem Werk " Der vollkommene Capellmeister" als Begriff erklärt und geprägt.
Hier gab es die musikalische Syntax, die der europäischen Sprache und der Rhetorik sehr ähnlich war: Einleitung, Hauptgedanken, Nebengedanken, Erörterung/Diskussion, Fazit, Schluss.
Ein grammatikalischer Satz mit Artikeln, Hauptwörtern, Adjektiven etc. hat in Verbindung mit den körperlichen Bewegungen und Gesten eines Redners gewisse musikalische Entsprechungen, wie ein Auftakt oder die Figuren (Tongruppen).
Die Emotionen wie Schmerz und nachlassender Schmerz werden z.B. durch die Harmonik beim Hörer erzeugt: Dissonanz und Auflösung.
Entlang der natürlichen Dynamik des Lufstroms beim Ausatmen (Sänger) gibt es in der alten Musik eine Detaildynamik des Einzeltons, d.h. der dynamisch statische Einzelton war die Ausnahme, nicht die Regel.
So wie die Zunge den Klangstrom beim Sprechen oder Singen von Vokalen wie a, e, u, o etc. moduliert und unterbricht, gibt es die reichhaltige Artikulation in der alten Musik, bei der man weite Intervalle eher stößt (Staccato, Portato) und enge Intervalle wie Sekunden eher bindet (Legato).
Die Frage ist immer, wie man das alles ausführt. Wenn etwa Trevor Pinnock die Berliner Philharmoniker mit Mozart dirigiert und Frau Pires spielt, dann beachtet er durchaus auch diese Regeln. Es klingt dann aber doch sehr anders, als es etwa bei den Freiburgern der Fall ist, deren Mozart-Klavierkonzerte ich zwar überhaupt nicht mag, die ich aber von der Besetzung - nicht von der gewollten Ruppigkeit her- den Aufführungen Schoonderwoerds vorziehe.
Bei der Artikulation ist es auch so: benutzt man sie, um eine Phrase verständlich zu machen, oder stellt man sie als Selbstwert derart heraus, dass es anfängt, unnatürlich und absurd zu klingen? Hier kommt der gute Geschmack ins Spiel, der sich eben im Laufe eines Lebens hoffentlich herausbildet.
Nur die Tatsache an sich, dass Schoonderwoerd keine dynamischen Extreme im Sinne eines verstörenden "Bellens" im Stile des Herrn Jacobs spielt, macht seine Ergebnisse für mich noch nicht genießbar. Das Musik nicht erschrecken, sondern kultiviert-angenehm unterhalten soll, mag ja für Boccherini stimmen, nicht aber für den Anfang des 4. Satzes der 9. von Beethoven. Ich finde, diesen Unterschied sollte man nicht übersehen.
Gleichzeitig bin ich auch der Meinung Günter Wands, Karajans, Karl Böhms und vieler anderer, dass ein guter Orchesterklang der Ausgangspunkt für große Kunst im Orchesterbereich sein sollte (durchaus analog zum Thema Klavierklang).
Was nützt der beste Ausdruckswille, wenn die Geigen sich wie das Geräusch einer elektrisch Säge in die Gehörgänge quälen, weil sie z.B. unsauber intonieren oder nur eine Farbe, nämlich das fahle Non-Vibrato kennen?
Das soll erst einmal genügen, muss wieder einmal zum Üben fahren....
LG
Glockenton
![]()