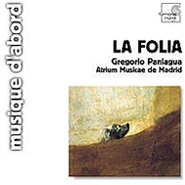Glaube als Voraussetzung?
Kern der Auseinandersetzung in diesem Thread ist die Aussage von Robert Stuhr: „Meiner Meinung nach kann man einen tiefen Zugang zu [...]s Musik nur erlangen, wenn man willens und in der Lage ist, das starke religiöse Element nicht nur rein intellektuell nachzuvollziehen, sondern aus vollem Herzen zu bejahen.[...]“
Diese These hat mit jeder anderen Glaubensaussage gemeinsam, dass sie nicht beweisbar ist: Ich sehe was, das du nicht siehst, und das ist unsichtbar... Man muss eben daran glauben. Denn wie müsste ein Beweis beschaffen sein, der die These „Nur gläubige Menschen haben einen wirklich tiefen Zugang zu religiöser Musik“ belegt? Er müsste zeigen, dass zum einen vom Sender, also dem Komponisten und dem Interpreten, Signale ausgehen, die ein Teil der Menschen empfängt, der andere nicht. Und zugleich müsste bewiesen werden, dass religiöse Menschen in der Lage sind, eine Botschaft zu empfangen, von der behauptet wird, dass sie real vorhanden ist, jedoch vom überwiegenden Teil der Menschen nicht vernommen wird.
Im Grunde ist an dieser Stelle die Diskussion beendet. Gläubige werden sagen: „Jawohl, so ist es“. Nicht religiöse Menschen werden milde lächelnd den Kopf schütteln und sich wieder ihren geliebten Bachkantaten zuwenden, oder welche Musik sie sonst gerade hören.
Jenseits der Geheimsprache
Für alle Leser mit genug Muße möchte ich die Fragestellung aber doch einmal aufdröseln.
Es sind zwei Thesen, die hier zu diskutieren sind:
1. Die erste besagt, dass Komponisten, die religiös sind und/oder religiöse Werke schreiben, nicht nur sich einer musikalischen Sprache bedienen, die von Menschen, die nicht religiös sind, nicht verstanden wird, sondern dass ihre Musik darüber hinaus etwas enthält, was nur ein religiöser Hörer empfinden kann. Die musikalische Sprache Bachs also, um einen Komponisten als Beispiel zu nehmen, bei dem ich mich ein wenig auskenne, enthalte nicht nur Verschlüsselungen, deren Code mit etwas Mühe von jedermann aufzulösen ist, sondern sei zusätzlich versehen mit Signalen, deren Empfang nur jemandem möglich ist, der sich selber als gläubig empfindet.
2. Zweitens wird behauptet, dass Musikhörer, die religiös sind, Musik auf eine andere (gemeint ist damit oft: tiefere, bessere) Art hören und empfinden, als es nicht-religiöse Hörer können. Religiöse Hörer sind sozusagen der Meinung, durch eine von religiösen Menschen komponierte Musik werde in ihnen selber eine Saite zum Klingen gebracht, die nicht-religiöse Menschen nicht hören können, weil diese Saite in ihnen gar nicht vorhanden ist. Das geht bis hin zu der Behauptung, dass nur gläubige Christen in der Lage seien, das Wesentliche solcher Musik zu erfassen.
Verstehen ist lernbar
Sehen wir uns diese beiden Thesen einmal näher an.
Zum Verständnis eines religiös motivierten Kunstwerks – da nähere ich mich dem Aussagegehalt einer Binsenweisheit – ist die Kenntnis des religiösen Kontextes und des kulturellen Hintergrundes unabdingbar. Wer die Bedeutung des Kreuzes für das Christentum nicht kennt, wird Bachs Kreuzstab-Kantate nicht wirklich verstehen können. Wer ein Seufzer-Motiv zwar erkennt, aber sich nicht klar macht, dass es in der Musik an dieser Stelle um die Grablegung Christi geht, hat ebenfalls Probleme, den Sinngehalt des Werkes zu erfassen. Wie Robert Stuhr schon sehr richtig gesagt hat: „Dafür ist sie geschrieben worden.“
Dies aber setzt nicht automatisch den religiösen Menschen in Vorteil, sondern jenen, der sich mit religiösen und kulturellen Kontexten intensiv beschäftigt hat. Je weiter wir in der Musikgeschichte zurück gehen, desto schwerer wiegt dieses Argument. Denn die religiöse Vorstellungswelt – auch dies fast eine Binsenweisheit – hat sich im Lauf der Jahrhunderte gewandelt. Von der Glaubenswelt der Luther-Zeit sind wir heute weit entfernt.
Nun ist aber in der Diskussion nicht so sehr von Verständnis, sondern vom Gefühl geredet worden. Etwa wenn Musicophil schreibt: „Es ist nicht hören, sondern empfinden. Und das Empfinden ist mehr als nur hören.“ Und geredet worden ist auch nicht nur von der dem Zeitenwandel unterworfenen religiösen Vorstellungswelt, sondern vom Glauben an und für sich, wenn ich Robert Stuhr richtig verstehe.
Verfechter der Ansicht, dass in der Musik religiöser Komponisten etwas enthalten sei, das nur gläubige Menschen erkennen können, werden sich an dieser Stelle vor dem Problem sehen, wie groß dieser Kreis der Gläubigen zu ziehen ist. Ist der Glaube an sich das Instrument der Erkenntnis, egal welcher Religion der Glaubende angehört, dann sollte nicht nur ein religiöser Menschen aus jedem beliebigen Kulturkreis die transzendentalen Schwingungen einer sagenwirmal Bachkantate empfinden, nein, dann müsste auch ein mitteleuropäischer Christ beim Hören von balinesischer Gamelan-Musik oder tibetanischer Gebetsgesänge tief ergriffen sein. Ich bezweifle das. Ist jedoch dezidiert der christliche Glaube notwendig, um die Tiefe einer Bachkantate ausloten zu können (Robert Stuhr: „Ob einer Protestant, Katholik oder orthodox ist, spielt mE bei christlicher Musik keine ausschlaggebende Rolle“), entsteht das Problem, dass (nebst den Atheisten natürlich) auch Hindus, Buddhisten, Muslime, Juden sowie sämtliche Nur-Namenschristen von den höheren Weihen der Erkenntnis ausgeschlossen sind. Da bleiben ja nicht mehr allzu viele übrig, global gesehen...
Aus was aber besteht dieses religiöse Signal, das der eine angeblich empfängt und der andere nicht? Welcher Akkord, welche Kadenz, welche Tonfolge löst dieses tiefere religiöse Empfinden aus?
Man könnte versuchen, dies am Agnus Dei aus Bachs h-moll-Messe zu belegen – wenn irgend in der Musik ein religiöser Sinngehalt augenfällig wird, dann hier in diesem innigen Flehen um Erbarmung. Die Musik stammt aus der weltlichen Hochzeitskantate „Auf! süß-entzückende Gewalt“ (BWV Anh. I, 14) von 1725. Bach hat sie dann ein erstes Mal 1735 für das Himmelfahrtsoratorium BWV 11 parodiert („Ach bleibe doch, mein liebstes Leben“), bevor er sie in der h-moll-Messe verwendete. Sollten sich die von religiösen Hörern erwarteten Signale finden lassen, so müssten sie in der Art der Umformung dieser Musik durch Bach zu finden sein; ich fürchte aber, wir suchen hier vergebens.
Besonders kritisch werden solche Behauptungen, wenn sie auch noch auf den Interpreten ausgedehnt werden. So etwa, wenn musicophil, also Paul, über einen Dirigenten schreibt, dessen Darbietung eines religiösen Werkes ihn nicht beeindrucken konnte: „Jahre später hörte ich, jene Dirigent sei nicht-Gläubiger. Und vielleicht ist es ihm dadurch nicht gelungen, die Essenz oder Quintessenz jener Passion zu erfahren oder zu vermitteln.“ Paul ist ein wirklich netter Mensch, und nach allem, was ich bisher von ihm gelesen habe, schätze ich ihn sehr. Aber auch nette Menschen können irren. Ungeachtet dessen, was er in jener Situation empfunden hat: daraus eine allgemein gültige Regel ableiten so wollen, erinnert mich an vulgär-anthropologische Behauptungen wie „Nur ein Schwarzer kann den echten Blues singen“ oder „Um Reggae zu fühlen, musst du Rastafari sein“.
Damit sind wir bei der zweiten These: dass religiöse Hörer Musik auf eine besondere Art hören, dass sie also so etwas wie einen siebten Sinn haben, der nicht-religiösen Menschen abgeht. Sozusagen die Antenne für die Signale, die der Komponist speziell für diese Klientel aussendet. Auch dies fällt wieder unter jene Art von Behauptungen, der für Glaubensaussagen typisch ist: sie sind unbeweisbar.
Musik zur Erbauung
Sicher ist allerdings – aber das geht nun wieder in den Bereich der Binsenweisheiten – dass religiöses Empfinden durch Musik, von der man weiß oder ahnt, dass sie einen religiösen Hintergrund hat, verstärkt und bestätigt wird. Im Titel dieses Threads „Musik für Fromme - oder - das religiöse Bonuselement“ ist ja der Zusatz-Nutzen angesprochen worden, den religiöse Hörer bei Musik haben, die für religiöse Zwecke oder mit religiösem Hintergrund geschaffen wurde. Das ist nach meiner Ansicht nicht nur ein Zusatz- sondern sogar ein Hauptnutzen, der sich aus dieser Musik entwickelt.
Allerdings ist dieser Teil solcher Musik für einen nicht-religiösen Hörer ebenso hörbar wie für den religiösen, nur dass er ihn nicht zum Erzeugen oder Nachvollziehen religiöser Gefühle und Rituale nutzt. Er wird das aber kaum als Manko empfinden. Und nur ein fanatischer Religionsgegner wird den Religiösen die Erbauung und den Trost missgönnen, den sie im sonntäglichen Hören einer Bachkantate finden. Eben so wenig, wie ich einem Pärchen, dass sich zum Liebesspiel regelmäßig Ravels „Bolero“ auflegt, dieses Tun missgönne. Ich sehe allerdings durchaus die Gefahr, dass jemand, der Bachs Musik als Vademecum, als Mittel und Anleitung zum Zweck religiösen Rührung und Erbauung benutzt, sich mit diesem Zweckdenken nur einen Faden aus dem Gewebe eines prächtigen Gobelins zieht und sich den Blick auf den ganzen Bach schwer macht.
So, und nun lege ich, wie oben angekündigt, eine meiner geliebten Bachkantaten auf. Sicher wird es viele Menschen geben, die ein tieferes Verständnis von dieser Musik haben als ich. Sollten sie das mit ihrer Religiosität begründen wollten, dann müssten sie es mir allerdings beweisen...
Alfons
![]()