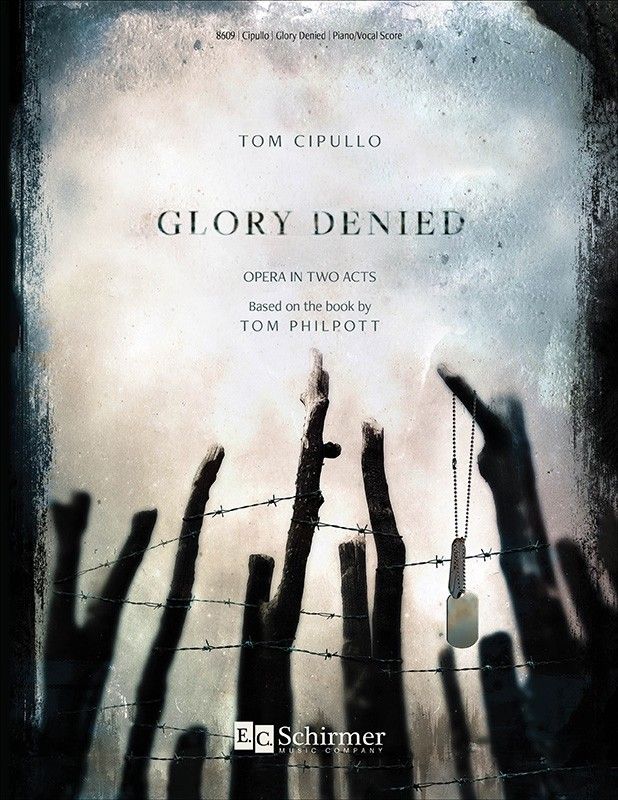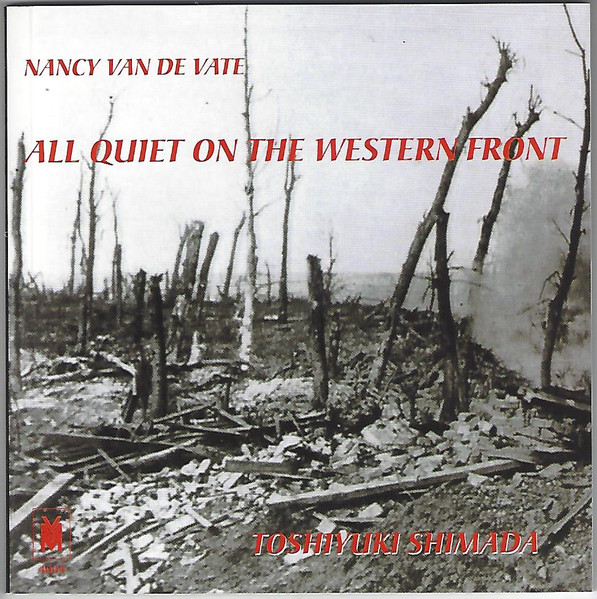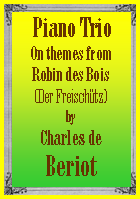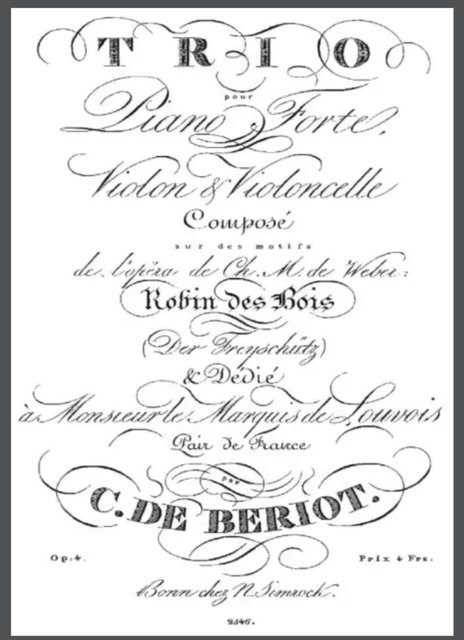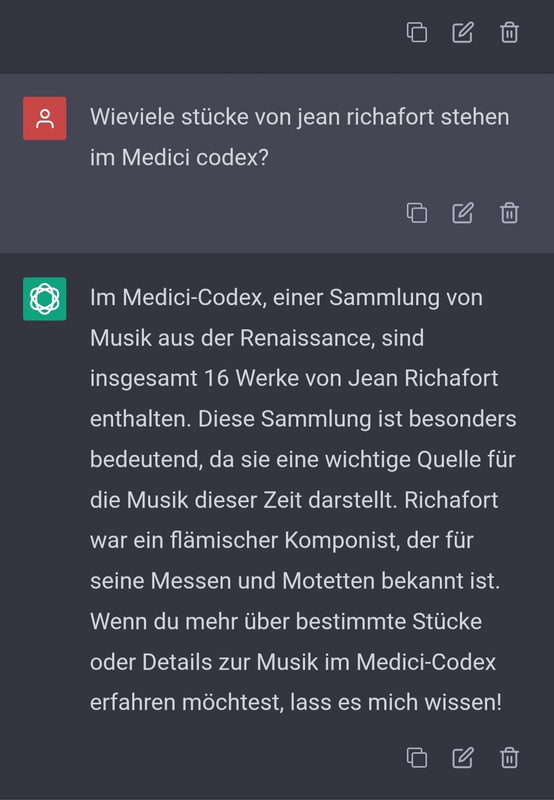Ich durfte ein verlängertes Wochenende in Zürich mit drei Einladungen zu Besuchen im Opernhaus verbringen.
4. Juli
"Les Contes d'Hoffmann" in der Fassung von Michael Kaye und Jean-Christophe Keck. Inszenierung von Andreas Homoki mit Saimir Pirgu und Marina Viotti.
Opera Vision wird die letzte Vorstellung am 12. Juli 2025 live aus dem Opernhaus streamen. Die Aufnahme wird im Anschluss als Video-on-Demand zur Verfügung gestellt.
Les Contes d'Hoffmann | Operavision https://share.google/tLrvi3ggll5LoYHQo
5. Juli
Zum Ende der Intendanz von Andreas Homoki dirigiert Fabio Luisi, ehemaliger Züricher Generalmusikdirektor, ein Galakonzert mit Ensemblemitgliedern und den Gästen Camilla Nylund, Klaus Florian Vogt und Bryn Terfel. Zu hören waren Ausschnitte aus "Tannhäuser", "Das Rheingold", "Lohengrin', das Duett «Glück, das mir verblieb» aus "Die tote Stadt" (Nylund/Vogt), das Duett «I can do better» aus "Annie Get Your Gun" (Terfel/Nylund), «Vissi d’arte» (Nylund) und das «Te deum» (Terfel) aus "Tosca" und «Miei rampolli femminini» (Terfel) und das Finale «Zitto zitto, piano piano» aus "La Cenerentola".
Man spürte, wie sehr das Publikum in Zürich die 13 Jahre der Ära Homoki zu schätzen wusste.
6. Juli
"Elias" - Oratorium von Felix Mendelssohn Bartholdy, szenische Aufführung in der Inszenierung von Andreas Homoki mit u.a. Christian Gerhaher und Julia Kleiter. Mit seiner wunderbaren Baritonstimme vermochte Gerhaher den Propheten überzeugend als Eiferer und Fanatiker, aber auch als Zweifler und im zweiten Teil als resignierten und gebrochenen Mann eindrucksvoll darzustellen.