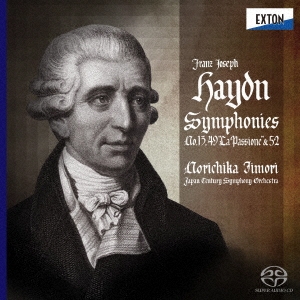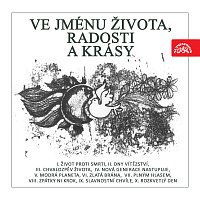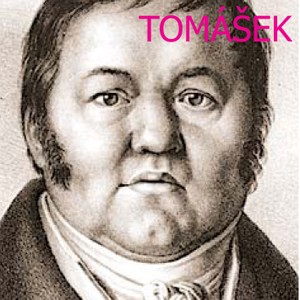Václav Dobiáš, geboren am 22. September 1909 in Radčice, damals Königreich Böhmen/Österreich-Ungarn, gestorben am 22. Mai 1978 in Prag, Tschechoslowakei (ČSSR), war ein tschechischer bzw. tschechoslowakischer Komponist.
Václav Dobiáš entstammte einer musikalischen Familie aus Radčice (Radschitz) im Bezirk Jablonec nad Nisou (Gablonz an der Neiße) in Nordböhmen (sein Vater spielte in einer örtlichen Kapelle, seine Onkel waren ebenfalls Musiker). Mit zehn Jahren wurde er Schüler des Violinvirtuosen Josef Muzika, seinerseits Schüler von Otakar Ševčík, und schrieb schon zu dieser Zeit seine ersten Kompositionen. Auch während seines Studiums in Jičín (1924-1928) komponierte er. Bereits 1928/29 unterrichtete er in Mukačev im Karpatenvorland und leitete während seines Militärdiensts in Josefov (1929/30) den dortigen Militärchor. Es folgten private Studien beim Komponisten Josef Bohuslav Foerster (1930/31), später in der Meisterklasse von Vítězslav Novák am Prager Konservatorium (1937-1939). Sein Komponistenkollege Alois Hába führte ihn in die sog. Mikrointervallkomposition ein. Auf diesem Felde bewies Dobiáš erkennbares Talent und ließ dieses moderne Idiom in seine eigenen Kompositionen einfließen. Erste Erfolge stellten sich mit seiner Kammersinfonie (1939, zugleich seine Abschlussarbeit), seiner Klaviersonate (1940) sowie seiner Sinfonie Nr. 1 (1943) ein. Infolge der deutschen Besatzung seines Heimatlandes fand er zunehmend zu einer von der tschechischen Nationaltradition inspirierten Tonsprache und komponierte zunächst große Männerchöre nach dem Vorbild Smetanas. Mit der Kantate "Stalingrad" (1945) erreichte dies einen frühen Höhepunkt. Nach der Befreiung Prags von der Wehrmacht und dem Einzug der sowjetischen Roten Armee im Mai 1945 wandte er sich aus Überzeugung der Sache des Kommunismus zu und wurde Mitglied der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei (KSČ). Das tschechische Volkslied, aber auch die Intonation von Sowjetliedern in Form sog. "Aufbau-Lieder" stellten einen erheblichen Teil seines Wirkens in den ersten Nachkriegsjahren dar. Daneben wären u.a. die Kantaten "Befehl Nr. 368" nach Stalins gleichnamigem Befehl vom 9. Mai 1945 (1946), "Zeremonielle Parade - Februar 1948" (1948) sowie "Baue die Heimat auf, du wirst den Frieden festigen" (1951) zu nennen. Letztere kann als musikalisches Symbol für den Aufbau des Sozialismus stehen und orientiert sich an Smetanas "Tschechischem Lied" von 1860. Nach dem kommunistischen Februarumsturz von 1948 avancierte Dobiáš zum linientreuen offiziellen Künstler des neuen Regimes, da seine Musik den Leitnormen des Sozialistischen Realismus entsprach und diesen teilweise sogar vorweggenommen hatte. Die vom sowjetischen Politbüro-Mitglied Andrej Shdanow im Februar 1948 angestoßene "antiformalistische Kampagne" unterstützte Dobiáš leidenschaftlich. Offiziellen Kritikern wie Antonín Sychra galt das prokommunistisches Werk von Václav Dobiáš im Allgemeinen als vorbildlich. Es nimmt insofern nicht wunder, dass seine Kompositionen häufig bei wichtigen Anlässen erklangen. Er selbst wurde zum gefragten Redner bei öffentlichen Diskursen über Musik. Gleichwohl gerieten Teile seines Frühwerks auf dem Höhepunkt des Spätstalinismus um 1950 zeitweise selbst in den Verdacht des "Formalismus" (dies betraf sogar die genannte "Stalingrad"-Kantate). Den berühmten Hussitenchoral "Die ihr Gottes Streiter seid" arrangierte er 1952 in einer monumentalen Bearbeitung für Bariton, Chor und Orchester (Klangbeispiel ganz unten). Sein womöglich wichtigstes Orchesterwerk, die etwa 50-minütige Sinfonie Nr. 2, schuf er in den Jahren 1956/57 (Klangbeispiel ganz unten). Sie galt schnell als Musterbeispiel einer idealtypischen sozialistischen Sinfonik. Das viersätzige dramatische Werk ist durch eine insgesamt gedrückte Stimmung geprägt, abgerundet durch einen Optimismus versprühenden triumphalen Schluss. Zeitgenössische Kritiker meinten eine stilistische und expressive Parallele zu Schostakowitschs Sinfonie Nr. 10 (1953) zu erkennen. Tatsächlich äußerte sich Václav Dobiáš dahingehend, eine Widerspiegelung der Ereignisse zwischen 1952 und 1957 in Musik gesetzt zu haben, vom Koreakrieg über die Hinrichtungen von Gegnern der Kommunistischen Partei der ČSSR, die offizielle Enthüllung der Verbrechen Stalins bis hin zum antikommunistischen Ungarnaufstand. Nichtsdestotrotz erhielt er für die 2. Sinfonie den Klement-Gottwald-Staatspreis. Kurz nach deren Uraufführung wurde Václav Dobiáš 1958 - für einen Komponisten ungewöhnlich - auf dem XI. Parteitag der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei Mitglied des Zentralkomitees der KSČ und sollte es für 13 Jahre bleiben. Ab 1960 saß er zudem als Abgeordneter in der Nationalversammlung bzw. ab 1969 in der nachfolgenden Föderalen Volkskammer, also dem tschechoslowakischen Parlament (bis 1971). Ferner gehörte er bereits seit 1949 dem Verband tschechoslowakischer Komponisten an und amtierte von 1952 bis 1963 als dessen Vorsitzender. Als Leiter der Musikabteilung im Kulturministerium (1946-1950) hatte er bereits Jahre zuvor den Minister beraten. Gleichwohl sollte, vielleicht auch bedingt durch sein zunehmendes politisches Engagement, kein großes Orchesterwerk mehr nachfolgen. Der Liedzyklus "Prags Einziger" (1961) nach Texten der stalinistischen Schriftstellerin Marie Pujmanová sowie die Festouvertüre (1965) bildeten gleichsam den Abschluss. Eine gewisse Ernüchterung über das kommunistische Regime ließ ihn gleichwohl nicht von seinem Glauben abweichen, dass es "in der gesamten sozialistischen Welt in den nächsten 20 oder 50 Jahren [...] ein irdisches Paradies geben wird". Das Jahr 1968 sollte für Václav Dobiáš, wie für viele Tschechoslowaken, einschneidend werden. Auf Druck von Vertretern des Reformkommunismus wurde er zum Rücktritt aus dem Komponistenverband gedrängt. Wenig später überschlugen sich infolge der Niederschlagung des Prager Frühlings durch Truppen des Warschauer Pakts im August 1968 die Ereignisse. Im Sommer 1969, kurz nach Beginn der "Normalisierung", erlitt Dobiáš einen Herzinfarkt. Nach seiner Genesung lehnte er das ihm vom neuen Generalsekretär Gustav Husák angebotene Amt des Kulturministers ab. Sein zwischenzeitlicher Bedeutungsverlust wurde durch das Obsiegen der konservativen Kräfte relativiert, doch zwangen ihn augenscheinlich gesundheitliche Gründe, seine Parteiämter im ZK und im Parlament auf dem XIV. Parteitag von 1971 aufzugeben. Zwischen 1974 und 1978 übernahm er noch die Leitung des Kommitees des Musikfestivals Prager Frühling. An der grundsätzlichen kommunistischen Überzeugung gibt es im Falle von Václav Dobiáš bis zuletzt keinen Zweifel, wie noch sein Alterswerk beweist, darunter das Lied "Grüße an den XV. Parteitag der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei" (1976). Von 1950 bis zu seinem Tode lehrte er als Professor für Komposition an der Akademie der Bildenden Künste in Prag. Zu seinen Schülern gehörten Josef Ceremuga, Václav Felix, Jiří Dvořáček, Ivan Řezáč, Miroslav Raichl, Zdeněk Zahradník, Eduard Dřízga, Jaroslav Rybář, Ivan Kurz, Václav Riedlbauch, František Koníček, Jaroslav Smolka, Jaroslav Kasan, Jiří Stivín und Bohuslav Ondráček. 1972 wurde er zum Verdienten Künstler und 1976 schließlich zum Volkskünstler der ČSSR ernannt. Nach seinem Ableben 1978 im 69. Lebensjahr verblasste seine über Jahrzehnte überragende Stellung in der Tschechoslowakei innerhalb kurzer Zeit.
(Unter Zuhilfenahme des Artikels im Tschechischen Musiklexikon von Personen und Institutionen, https://slovnik.ceskyhudebnisl…int&tmpl=component&id=922)

Václav Dobiáš mit Dmitri Schostakowitsch
Der Fall Václav Dobiáš scheint auf den ersten Blick der eines systemtreuen Vorzeigekommunisten zu sein und erinnert oberflächlich an Tichon Chrennikow, den langjährigen Generalsekretär/Ersten Sekretär des Sowjetischen Komponistenverbands. Gleichwohl verband ihn eine Freundschaft mit den Komponisten Dmitri Schostakowitsch und Arthur Honegger. Zu seinem engsten Freundeskreis gehörte das Ehepaar Jaroslav Krombholc (Dirigent) und Marie Tauberová (Sopranistin). International war Dobiáš angesehen und traf u.a. Benjamin Britten und Peter Pears. Sein Œuvre wurde von so bedeutenden Dirigenten wie Karel Ančerl, Ladislav Slovák, Václav Neumann, Rafael Kubelík, Alois Klíma, Vladimír Válek und Jiří Pinkas aufgeführt. Supraphon spielte seine wichtigsten Werke ein, teilweise mehrfach. Besonders die 2. Sinfonie würde mehr Aufmerksamkeit verdienen. Victor Carr Jr von Classics Today rezensierte die Ančerl-Einspielung von 1960 (übrigens eine der frühesten Stereoproduktionen von Supraphon) wie folgt: "Die Tschechische Philharmonie zelebriert Dobiáš' lebendige Orchestrierung, während Ančerls kraftvolles Dirigat die Sinfonie unterstreicht - sie sollte unbedingt von heutigen Orchestern gespielt werden (vor allem das Adagio wäre ein Publikumserfolg)."

Václav Dobiáš mit Benjamin Britten und Peter Pears
Diskographie (auszugsweise):

Sinfonie Nr. 2
Tschechische Philharmonie
Dirigent: Karel Ančerl
1960 Stereo

Kantate "Baue die Heimat auf, du wirst den Frieden festigen"
Tschechischer Chor
Kinderchor
Tschechische Philharmonie
Dirigent: Karel Ančerl
1951 Mono

Kantate "Stalingrad"
Zdeněk Otava, Bariton
Armee-Ensemble
Männerchor Typografia
Tschechische Philharmonie
Dirigent: Rafael Kubelík
1945 Mono
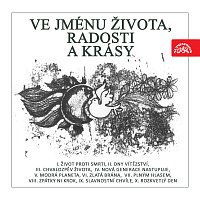 Digital
Digital
Kantate "Stalingrad"
René Tuček, Bariton
Chor und Sinfonieorchester des Tschechoslowakischen Rundfunks
Dirigent: Jaroslav Krombholc
1975 Stereo
 Digital
Digital
"Zeremonielle Parade - Februar 1948"
Chor des Tschechoslowakischen Rundfunks
Prager Sinfoniker
Dirigent: Ladislav Slovák
1972 Stereo
 Digital
Digital
"Festivalová"
Chor und Sinfonieorchester des Tschechoslowakischen Rundfunks
Dirigent: Jiří Pinkas
1953 Mono
 Digital
Digital
"Die ihr Gottes Streiter seid" (Hussitisches Kampflied, 1420; Bearbeitung für Bariton, Chor und Orchester)
Ilja Doležal, Bariton
Künstlerisches Armee-Ensemble Vít Nejedlý
Dirigent: Jaromír Nohejl
1953 Mono