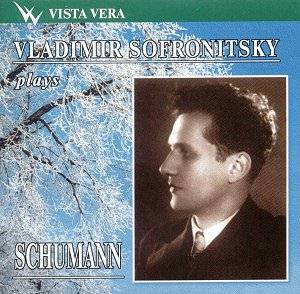Hallo, Freunde der deutschen Romantik,
die „Gesänge der Frühe“ versprechen beides: Schumann und Hölderlin. Und – sie leiten über zu Bruckner (besonders das 3. und 5. Stück). Auch wenn ich die abschließende Schlussfolgerung nicht mehr teilen kann, sei aus der schönen Schumann-Seite auf der Homepage des Pianisten Franz Vorraber zitiert:
„Die Gesänge der Frühe haben eine ganz eigene Färbung. Getreu Schumanns Motto, das in jeder Musik ein bißchen Frühling sein sollte, spürt man in seinem letzten veröffentlichtem Werk, das Herannahen des Morgens, die rufende Quint, die Hoffnung auf Licht, eine Harmonik, die eine Schlußwirkung oft ausspart erinnernd an Brucknersche Choräle, eine Verwandtschaft zu Beethovens letzter Sonate op.111 in den Trillerfiguren des letzten Stückes. Sein Lebenswerk ist vollbracht. Diese befreiende Ruhe machen die Gesänge der Frühe zu einem außergewöhnlichen Zeugnis seines Wirkens gegenüber seinem Schicksal. “

Anfang des 1. Stücks mit dem Kernmotiv Diotima - Hyperion
Entstehung, Widmung an Bettina von Arnim
"Diotima, Gesänge der Frühe" ist wie das Violinkonzert bereits 1849-50 im Projektenbuch aufgeführt. Schumann schrieb das Stück vom 15. - 18. Okt. 1853, also unmittelbar unter dem Eindruck des ersten Besuchs von Brahms. Das hat zu ausführlichen Analysen möglicher Einflüsse geführt, so im Nachwort zur Herausgabe des Urtextes (Link )
Clara Schumann schrieb am 18.10.1853 in ihr Tagebuch: "Robert hat 5 Frühgesänge komponiert, - ganz originelle Stücke wieder, aber schwer aufzufassen, es ist so eine ganz eigne Stimmung darin."
Ende Oktober 1853 besuchte Bettina von Arnim mit ihrer Tochter Gisela die Schumanns, als Joachim dort war. Joachim war mit Gisela befreundet, und Schumann beglückwünschte ihn bald - missverstehend – zur Verlobung. Umgekehrt wird Bettina deutlich gesehen haben, was dort geschah. Brahms war auch noch in Düsseldorf. Schumann änderte die unbestimmte Widmung an Diotima, womit idealisierend Clara gemeint sein konnte, "an die hohe Dichterin Bettina".
Bettina von Arnim hatte Jahrzehnte früher Gedichte von Hölderlin vertont und ihn in seinem Turm in Tübingen besucht. Es muss für sie ein Schock gewesen sein, dann wenig später im Mai 1855 Schumann in einem Irrenhaus zu besuchen - und nach ihrem Eindruck gesund vorzufinden.
Brahms und Joachim wussten nicht, wer mit Diotima gemeint war. Da Joachim kurz darauf eine Hyperion-Sinfonie komponieren wollte, hat Hölderlin offenbar den Roman von Hölderlin als Quelle genannt. Aber auch die Gedichte an Diotima können gemeint sind. Dessen letzte Version beginnt „Du schweigst und duldest, denn sie verstehn dich nicht“, endet aber hoffnungsfroh.
Die Veröffentlichung war ihm wichtiger als bei anderen Werken. Er hatte bereits am 17. Feb. 1854 die Eingebung des choral-artigen Engels-Themas gehabt, aus dem dann die Geister-Variationen entstanden, als er am 24. Feb. 1854 wenige Tage vor seinem Selbstmordversuch in einem Brief seinem Verleger schrieb: „Ich möchte die Fughetten [op. 126] wegen ihres meist melancholischen Charakters nicht erscheinen lassen und biete Ihnen ein Anderes, vor Kurzem beendigtes Werk: ‚Gesänge der Frühe’. ... Es sind Musikstücke, die die Empfindungen beim Herannahen und Wachsen des Morgens schildern, aber mehr aus Gefühlsausdruck als Malerei."
Hier nimmt er deutlich auf Beethovens "Pastorale" Bezug, ihrem "Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande" (Überschrift des 1. Satzes) und ihrer Kennzeichnung "Mehr Ausdruck der Empfindung als Mahlerey".
An diese Stücke war die Hoffnung auf einen Ausweg aus seiner tiefen persönlichen Krise gebunden. Als Nachweis der Nähe des Wahnsinns wurde später vor allem der melancholische Charakter der Werke von 1853 genannt. Aber gerade davon wollte er sich lösen. Mit der Frühe ist sicher auch die eigene Frühe gemeint, die Jugendzeit, als er zum erstenmal Hölderlin las und voller Ideale war. Ihm kamen immer mehr Zweifel, ob Clara das hielt, was er als Ideal in ihr zu sehen wünschte.
„O trinke Morgenlüfte“
„Empfindungen beim Herannahen und Wachsen des Morgens“ trifft eher die Sprache von Hölderlin als der Titel „Gesänge der Frühe“. Dieser bezieht sich vielmehr auf dessen „Nachtgesänge“, die Schumann sicher kannte. Mit den „Nachtgesängen“ hatte Hölderlin eine kleine Auswahl seiner Gedichte veröffentlicht, und Schumann möchte dies – so verstehe ich ihn – fortführen, indem er eine andere Seite in den Gedichten Hölderlins aufgreift, die nicht in den Nachtgesängen enthalten sind.
„O trinke Morgenlüfte“ ist eine Zeile aus „Germanien“. Hölderlin entwirft eine völlig anderes Bild der Germania, als es dann im 19. Jahrhundert populär wurde. Sie ist „im Wald verstekt und blühendem Mohn voll süßen Schlummers“. Hölderlin wünscht ihr, dass sie die Morgenlüfte trinkend offen wird, das Ungesprochene so zu umschreiben, dass es nicht länger Geheimnis bleibt. – Hier möchte ich nur anregen, diese Gedichte zu lesen.
Wenige Jahre vorher hatte Hölderlin ein Gedicht „Deutscher Gesang“ entworfen.
Wenn der Morgen trunken begeisternd heraufgeht
Und der Vogel sein Lied beginnt,
und Stralen der Strom wirft, und rascher hinab
die rauhe Bahn geht über den Fels,
weil ihn die Sonne gewärmet
...
Dann sitzt im tiefen Schatten,
wenn über dem Haupt die Ulme säuselt,
am kühlathmenden Bache der deutsche Dichter
und singt, wenn er des heiligen nüchternen Wassers
genug getrunken, fernhin lauschend in die Stille.“
Ich glaube, dass dies sehr gut Schumanns Selbstverständnis beschreibt. - Aus den vorhandenen Aufnahmen habe ich mir die mit Andras Schiff ausgesucht, weil ich mir gut vorstellen konnte, dass ein Pianist mit Bartok-Erfahrung den Klang Schumanns treffen kann. Das war keine Enttäuschung.
Viele Grüße,
Walter