Beiträge von Dr. Holger Kaletha
-
-
Auch ich war während des Aufenthaltes in Nessebar. Ich werde dir einige Fotos aus Nessebar zumailen.
Das freut mich, lieber Willi. Von mir bekommst Du dann andere Fotos zurück!
Herzlich grüßend
Holger -
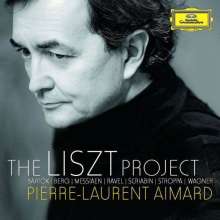
Lieber Jörn,
manchmal verschiebt das intensive Nachhören doch die abgespeicherten Eindrücke! Ich finde heute auch – das Tempo ist zu langsam. Warum nimmt er nur Vallée d´Oberman in solch einem langsamen Gang? Ein zentraler Begriff in der romantischen Musikphilosophie ist „Enthusiasmus“ – die Emphase, den Enthusiasmus, ihn treibt Aimard Liszts Musik mit fast schon „deutscher“ Gründlichkeit aus. Warum hatte ich diese Aufnahme nur so „positiv“ vermerkt damals? Weil Aimard, der mit Neuer Musik groß geworden ist, durchaus Sinn für Rhetorik hat – jedoch muss ich jetzt sagen: aber... Schon zu Beginn im schleppenden Tempo (was eher Lento ist als Lento assai) hat man das Empfinden, dass Aimard sehr plastisch und klar phrasiert, aber einen „sprechenden“ Ton im Sinne einer Purifizierung praktiziert: da wird artikuliert, jedoch so, dass sich die Artikulation vor der Sentimentalität gleichsam schämt, sie geradezu ersetzt. Die lastenden, absteigenden Skalen zu Beginn, sie lasten nicht im Sinne einer schwermütigen Befindlichkeit, sie klingen nur einfach „langsam“. Geradezu hypersorgfältig wird die „Struktur“ betont – die rhythmische Figur. Aber sie hat letztlich doch keine Bedeutungsschwere. Zweifellos ist das nicht ohne Empfindsamkeit gespielt – aber das ist mehr die lichte Empfindung von „objektivem“ Debussy, als aufgewühlte romantische Subjektivität mit ihrer Tendenz zur narzistischen Nabelschau, welche in die verborgene Innenwelt einer verzweifelten Seele blicken lässt. Aimard sagt zum Verhältnis von Messiaen und Liszt:
„Mit Messiaens Le Traquet stapazin und dem Vallée d´Oberman stehen sich dann zwei große Kompositionen gegenüber, die Natur und Zeit aus unterschiedlichen Perspektiven thematisieren: bei Messiaen objektivierend als geordnete Natur und als meditatives Erleben der Zeit im Durchstreichen eines Tages, bei Liszt subjektivierend als Ringen des Künstlers mit der Nacht als Symbol des Durchschreitens der menschlichen Zeit.“
Ob es ihm aber gelungen ist, diesen Unterschied von „objektiver“ und „subjektiver“, von Naturzweit und menschlicher Zeit, wirklich deutlich zu machen? Daran habe ich beim Wiederhören meine großen Zweifel. Aimard spricht in Bezug auf das 19. Jahrhundert der „Fähigkeit der Musik zur assoziativen Darstellung“. Genau das steht hier aber der Darstellung von „menschlicher“ Zeit im Wege: Die Langsamkeit, mit der sich die Musik bei Aimard fortbewegt, durchkreuzt das Durchlaufen menschlicher Zeit: Statt dass die musikalische Zeit dynamisch zwischen Höhen und Tiefen sich bewegt – einen großen Spannungs- und dynamischen Steigerungsbogen aufbaut, so etwas wie eine „Wellendynamik“ des Gefühls, zerfällt sie in Einzelassoziationen. Vallée d´Oberman lebt von den Charakterwechseln der verschiedenen formalen Abschnitte – eben die verschwinden schlicht in Aimards Fixierung auf die behutsame Darstellung von Einzelphrasen. Alles klingt – assoziativ von Moment zu Moment weitergehört – im Ausdruckscharakter eher gleich. Die fehlende Emphase und „Begeisterung“ – Aimards junonisch-nüchterne Spierlweise tut ihr Übriges dazu. So ohne jede Fähigkeit zur Betörung habe ich die pp dolcissimo-Passage Takt 75 ff. noch nicht gehört. Das ist „Romantik“ – Musik soll verführen, berauschen, becircen. Genau dem versagt sich der Rationalist Aimard vollständig. Das ist dermaßen „ehrlich“ gespielt, eben nur die Musik und sonst nichts, dass es somit fast schon „objektiv“ langweilig wird ohne aber „subjektiv“ Langeweile auszurücken. Das Recitativo beginnt durchaus rhetorisch-plastisch – aber die Ausbrüche, die Extreme, sind abgemildert. Da steht Takt 127 ff appassionato – das ist weder Fortissimo noch Appassionato bei Aimard. Dagegen kostet er die Pausen des Lento zum Schluss dieses Recitativs geradezu theatralisch aus. „Schauspielern“ darf diese Musik – denn einem Schauspiel schaut man zu, man wahrt Distanz zum Geschehen auf der musikalischen Bühne, dass man eben nur „sieht“. Einfühlungsvermögen besitzt Aimard zweifellos – sehr klug, wie er das gesangliche Lento-Thema Takt 170 ff. fließen lässt. Nicht zuletzt: Die Darstellung der Finalapotheose ist entscheidend. Gerade hier versagt finde ich Aimards neusachlicher Ansatz – die „Per-aspera-ad-astra“ (Durchs Dunkel zum Licht-) Dramaturgie ist einfach nicht mehr nachvollziehbar. Es verwundert nicht, dass Aimard die Ossia-Variante wählt und nicht die Tremoli in der rechten Hand, welche die emphatische Schlussapotheose vorbereitend aufbauen helfen. Wohl niemand spielt diesen Finalrausch so ganz ohne jede Rauschhaftigkeit, dermaßen ausstrahlungslos. Dem Dionysischen kann man jedoch seine Emphase nicht nehmen, ohne dass sein erotischer Zauber schlicht vergeht. Dieser Schlusshymnus kommt völlig unbetörend an die Ohren, so dass an diesem Eindruck auch nicht Aimards Tempo- und Dynamiksteigerung zum Schluss hin etwas ändern kann. Es zeigt sich: Pure Tempobeschleunigung ist noch keine menschliche Zeit, sie ersetzt keine Emphase, sondern bleibt ihr doch sehr stumpfer Abglanz. Aimard hat Liszt nicht nur Messiaen gegenübergestellt, er hat romantische Subjektivität der zeitlichen Objektivität der Moderne angenähert, Liszt am Schluss (Vallée d´Oberman ist das letzte Stück auf der CD) als Nachklang von Messiaens Moderne interpretiert, die subjektive Zeit damit allzu sehr der objektiven nahegerückt. Als radikales „Experiment“, Liszt „modern“ zu nehmen, ist das sicher eine erhellende Aufnahme. Nur ans Licht kommt so letztlich die Wahrheit, dass gerade dieser „extreme“, subjektivistische Liszt neusachliche Purifizierung nicht erträgt.
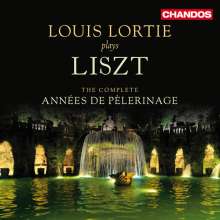
Die Subjektivität, die Aimard gewissermaßen ausklammert, bei Louis Lortie spricht sie sich aus von Anfang an. Gleich zu Beginn ist das naturzeitliche Ebenmaß weg – metrische Ungleichmäßigkeit erzeugt den Eindruck von Aufgeregtheit und Verwirrung. Auch das ist zwar keine schwer lastende Schwermut und dieser Expressivität mangelt es auch ein bisschen an Tiefe – den Abgründen wirklich quälerischer Verzweiflung. So fehlt der Piu lento-Passage Takt 26 ff. die schwer wiegende Nachdenklichkeit, der ihr pianistische Schwergewichte wie Arrau, Berman, Brendel oder Richter verleihen können. Die Schlusspassage des 1. Teils ist eindeutig Horowitz abgehört. Beim Recitativo profitiert Lortie vom Rolls Royce unter den Flügeln – dem in dieser Aufnahme verwendeten Fazioli. Eine solche Dynamik und Basssubstanz –und dazu perfekte Ausgewogenheit – hat ein Steinway einfach nicht zu bieten! Da braucht Lortie nicht viel zu tun, die Wirkung produziert das Instrument wie von selbst. Die Presto-Passage (ff tempestuoso) ist geradezu umwerfend furios gespielt – da „explodiert“ das Instrument förmlich. Hier kommen das Können des Pianisten und die überragende Qualität des Instruments glücklich zusammen. Der Lento-Abgesang gelingt Lortie vorzüglich – sehr expressiv, ohne jegliche Theatralik. Beim Takt 170 einsetzenden Thema betört der Fazioli geradezu mit wunderbar leisen Melodieton und einem schwarz drohend dahingehauchten dolce-Baß. Auch Lortie wählt die Ossia-Variante, die aber auf dem Fazioli bedrohliche Fülle bekommt. Der Schluss überfällt einen dann quasi novellistisch-einbruchshaft mit seiner Turbulenz. Das ist alles ein bisschen zu vordergründig laut eigentlich – ja eigentlich, denn der Fazioli-Flügel lärmt schlicht im Fortissimo nie! (Auf einem Steinway wäre der harte Lortie-Anschlag hier sicher ähnlich störend-aufdringlich wie bei Korstick.). Der Schluss erscheint bei Lortie zwar auch nicht „gebrochen“, aber setzt sich doch vom vorherigen Oktavenrausch ab durch gefassten Trotz. Insgesamt eine wirklich hörenswerte Aufnahme (12 Minuten) – mit einem fantastisch klingenden Fazioli-Flügel und einer ebenso vorzüglichen Aufnahmetechnik!
Herzlich grüßend
Holger -
Alles anzeigen
Lieber Holger,
als ich vor knapp drei Jahren einen zweiwöchigen Kururlaub in Pomorje, im Grand Hotel Pomorje, nahe Burgas verbrachte, kam ich durch eine Weinprobe in einem Weingut in der Näher von Pomorje auf die Spur eines 15 Jahre alten bulgarischen Brandys, den ich mir kaufte und mit nach Hause nahm. Er schmeckte köstlich, und ich habe lange etwas davon gehabt. Ich habe mir damals vorgenommen, da noch einmal hinzufahren, nicht wegen des Brandys, sondern weil es da noch so viel zu entdecken gibt, was man beim ersten Mal alles nicht wahrnhehmen konnte.
Liebe Grüße
Willi

"
P.S. In einem bezaubernden Straßencafé in der Fußgängerzone von Burgas kostete ein zwölfjähriger Single Malt der Marke "Macallan nur ein Sechstel dessen, was ich in unserem Hotel dafür bezahlen musste.Lieber Willi,
Pomorie - da fahre ich demnächst wieder durch!
 Unser Bus von Sofia fährt nämlich über Burgas und Pomorie die Küste entlang nach Nessebar (Slanchev Bryag ist der Sonnenstrand):
Unser Bus von Sofia fährt nämlich über Burgas und Pomorie die Küste entlang nach Nessebar (Slanchev Bryag ist der Sonnenstrand):
Zuletzt war ich doch sehr erschreckt - ich kenne diesen Küstenabschnitt ja nun seit 20 Jahren! Sie haben in den letzten Jahren die komplette Küste regelrecht zugebaut, da gibt es zwischendrin keinen freien Fleck mehr. Deswegen sind wir gerne in Nessebar mit seiner schönen Altstadt (UNESCO-Weltkulturerbe), da gibt es ein "Zentrum" und nicht diese endlosen Touristenstraßen. Und auf die großen Hotels am Sonnestrand sind wir sowieso nicht angewiesen - wir wohnen in einem vorzüglichen kleinen privaten Hotel in Nessebar für 15 Euro pro Nacht (mit Klimaanlage, Aufzug und allem drum und dran). In Bulgarien kann man wirklich sehr preiswert und gut Urlaub machen. Ganz früher konnte man auch nur den Charterflug allein ohne Hotel nach Burgas buchen (mit den alten Tupulevs der Balkan Air). Das geht heute nicht mehr - nur noch mit WIZZ per Linienflug nach Sofia und dann mit dem Bus.
Nessebar, Hafen
Der Pomorie-Schnaps und Brandy ist hervorragend - wir haben ihn oft getrunken und verschenkt!

P.S. Ich hoffe, Beethoven und die Pathetique können diesen kleinen alkoholischen Exkurs vertragen und werden nicht gleich besoffen!

Herzlich grüßend
Holger -
P.S. Dieses war meine 555. Rezension, und da das eine Schnapszahl ist, werde ich mir nun einen kleinen Single Malt genehmigen, einen 12jährigen Aberlour.
Den hast du Dir wahrlich verdient (nach dieser offenbar vielversprechenden Enmtdeckung), lieber Willi! Prost! Natrave! (Mein bulgarischer Schnaps ist leider alle - Nachschub ist aber in Sicht!)



Herzlich grüßend
Holger -
Lieber Jörn,
wunderbar, Deine wieder einmal ungemein differenzierte und tiefschürfende Besprechung nun von Aimard zu lesen!
 Morgen oder am Mittwooch komme ich zum "Nachhören"! Als ich die CD erstand, war ich doch positiv überrascht, wie expressiv doch ein eher "rationalistischer" Interpret wie er Vallee d´Oberman spielen kann. Nun bin ich selbst gespannt, wie ich das nach einigem zeitlichen Abstand wahrnehmen werde. (Die Schirmer-Aufnahme hast Du inzwischen auch?)
Morgen oder am Mittwooch komme ich zum "Nachhören"! Als ich die CD erstand, war ich doch positiv überrascht, wie expressiv doch ein eher "rationalistischer" Interpret wie er Vallee d´Oberman spielen kann. Nun bin ich selbst gespannt, wie ich das nach einigem zeitlichen Abstand wahrnehmen werde. (Die Schirmer-Aufnahme hast Du inzwischen auch?) 
Mit herzlichen Grüßen
Holger -
Ja! Bloß traktiert heutzutage kein Solist einen kostbaren musealen Hammerflügel so, dass dem der Rahmen bricht. Er spielt ihn verhaltener, er schont ihn (die Vermeidung sonstiger Störgeräusche mal aussen vor gelassen.), was dann aber wieder im Widerspruch zum ideellen Anspruch von HIP und der Intention des Komponisten steht.
Und ein verhaltenes Spiel kann letztendlich auch die Tontechnik nicht wettmachen. Das merkt man einfach.Meistens werden ja auch Nachbauten gespielt, welche - bautechnisch verändert - die heutigen Belastungen aushalten. Man darf auch den Wandel der Aufführungspraxis nicht vergessen: Liszt war überhaupt der erste, der einen reinen Klavierabend gab. Davor waren Mischprogramme üblich mit Gesang, anderen Instrumenten. Da war die Belastung für das Klavier entsprechend deutlich geringer. Dass die Rahmen bei Liszt brachen, hat also primär darin seine Ursache und nicht einer vermeintlich robusten Spielweise.
Schöne Grüße
Holger -
Dieses Argument hört man oft. Trotzdem halte ich es für falsch. Wenn ich nicht mehr so gut sehe, freue ich mich über ein gut gesetztes und gedrucktes Buch, das erleichtert mir das Lesen. Wenn meine Ohren nicht mehr so gut sind, ist es auch umso wichtiger, dass die Stereoanlage möglichst viel musikalische Information wiedergibt und möglichst wenig verschluckt oder verfärbt, da kann die Anlage eigentlich gar nicht gut genug sein.
So denke ich auch!
-
Und dann ist da noch die Sache mit dem Schonen des Instrumentes:
Langt ein Kenner und Liebhaber alter Instrumente bei einem ca. 200 Jahre alten Flügel so in die Tasten, wie es der Komponist verlangt, oder legt er nicht eine gewisse Zurückhaltung aus Respekt vor der handwerklichen Leistung und dem Alter des Instrumentes an den Tag?
Außerdem: was kostet ein gut erhaltener und restaurierter Flügel aus der Zeit Beethovens? Was kostet ein Nachbau? Und bei welchem Instrument ist der Schaden größer, der eventuell angerichtet werden kann?
Lieber John,Franz Liszt verschliss zwei bis drei von diesen Dingern pro Konzertabend. Der Grund: Der Holzrahmen (die Erfindung des Stahlrahmens war noch nicht gemacht) hielt der Belastung der Saitenspannung nicht stand und brach mitten durch!

Schöne Grüße
Holger -
Na ja, mit 200 braucht man schon ein wenig Schonung. Ich habe aus gegebenem Anlass den untenstehenden Thread wieder reanimiert. Er ist zwar noch keinen noch keine 200 Jahre alt, wurde aber die letzten 8 Jahre geschont.....
... na ja, eine Stradivari-Geige, die Jahrhunderte alt ist, braucht solche Schonung nicht! Ein Instrument ist letztlich ein Werkzeug (von instrumentum) - was soll ich mit einem alten Hammer, den ich schonend einsetzen muß? Entweder es ist brauchbar oder nicht. Dein Posting mit dem Vergleich CD-Live fand ich sehr treffend. Die CD kaschiert sehr schön das Problem. Wenn man bedenkt, dass das Gewandhausorchester mal mit 27 Musikern angefangen hat und Mendelssohn unglaublich stolz war, dass er es um 13 Musiker vergrößern konnte, dann kann man sich vorstellen, warum ein solches Instrument einer heutigen Orchesterbesetzung ohne solche zahlenmäßigen Beschränkungen nicht gewachsen ist.
Ein Instrument ist letztlich ein Werkzeug (von instrumentum) - was soll ich mit einem alten Hammer, den ich schonend einsetzen muß? Entweder es ist brauchbar oder nicht. Dein Posting mit dem Vergleich CD-Live fand ich sehr treffend. Die CD kaschiert sehr schön das Problem. Wenn man bedenkt, dass das Gewandhausorchester mal mit 27 Musikern angefangen hat und Mendelssohn unglaublich stolz war, dass er es um 13 Musiker vergrößern konnte, dann kann man sich vorstellen, warum ein solches Instrument einer heutigen Orchesterbesetzung ohne solche zahlenmäßigen Beschränkungen nicht gewachsen ist. 
Schöne Grüße
Holger -
Vielleicht war es ein historischer Flügel, der geschont werden hat müssen.
John
Das ist der beste Witz seit langem! Der arme Hammerflügel braucht Schonung, weil er Beethoven nicht gewachsen ist!



Schöne Grüße
Holger -
 Man tritt Herrn Chailly aber sicher nicht zu nahe, wenn man den wesentlichen Anteil an der Legende Martha Argerich zuschreibt.
Man tritt Herrn Chailly aber sicher nicht zu nahe, wenn man den wesentlichen Anteil an der Legende Martha Argerich zuschreibt. 
Na klar!
 Er ist da wohl auch ganz Gentleman, der Dame hier den Vortritt zu lassen!
Er ist da wohl auch ganz Gentleman, der Dame hier den Vortritt zu lassen! 
Schöne Grüße
Holger -
Sind das nun Beispiele für "herausragend" oder "misslungen"?
 Die Argerich und Chailly mit Rachmaninow 3 - das ist eine Legende!
Die Argerich und Chailly mit Rachmaninow 3 - das ist eine Legende! 
Schöne Grüße
Holger -
das hört sich doch gut an. Machen wir einige Nachträge und dann setzen wir nach Deiner Rückkehr ganz in Ruhe die Betrachtung mit Band 2 fort. Für Band 2 könnten wir ja im Wechsel einen kleinen einführenden Text nebst dem Bildwerk, auf das sich Liszt bezieht - verfassen. Ich komme am Wochenende dazu, zu sichten, welche Aufnahmen ich noch habe und dann wieder ausgiebig Liszt zu hören.
Lieber Jörn,das ist doch sehr schön! Einführende Texte habe ich schon auf meinem PC, vor drei, vier Jahren geschrieben (länger und kürzer) - auch da können wir uns gut ergänzen! Ich freue mich schon. Das ist eine gute Idee - meine Aufnahmen werde ich auch sichten. Man weiß sonst nicht, was man eigentlich hat.
 Hören kann ich dann ab Dienstag.
Hören kann ich dann ab Dienstag. 
Herzlich grüßend
Holger -
Allerdings spielt vielleicht auch die relativ direkte Mikrophonierung dieser Orfeo-Aufnahme eine gewisse Rolle. Wenn man nicht einen gewissen Raumanteil hinzunimmt und nicht einen gewissen Abstand einhält, dann kann es irgendwann "bollerig" werden, wie der Bielefelder sagt

Das ist gut gesagt mit dem gewissen..., lieber Glockenton. Bei Michelangeli kann man die Mikros direkt unter den Deckel hängen, und es klingt nie "bollerig". Er schaltet eben den Arm aus und spielt aus dem Handgelenk - deshalb "klingt" der Flügel auch im Fortissimo immer noch. Das ist das Bewundernswerte bei seinen singulären Paganini-Variationen, dass bei diesen haarsträubenden Schwierigkeiten der Flügel stets wunderbar klingt, egal wie "laut" es wird. Selbst bei Richter wird es dagegen bei diesem Stück im Forte bisweilen auch schon häßlich - das Instrument ächzt und stöhnt bei diesen Forte-Massen, während bei ABM der Flügel nie "schwitzen" muß. Bei Gilels klingt der Flügel trotz der Riesendynamik im Fortissimo auch nie hohl und scharf. Denn er setzt zwar das Argewicht ein, schafft es aber, den Druck in der Fingerkuppe zu bündeln, d.h. der Ton wird so eben nicht von oben in die Tasten "gestoßen" - dann scheppert nämlich der Flügel oder der Ton ist gar ganz weg. (Für unschönes Forte gibt es ja eine illustre Reihe von Klaviergrößen: Gawrilow, Korstick usw. usw.
Er schaltet eben den Arm aus und spielt aus dem Handgelenk - deshalb "klingt" der Flügel auch im Fortissimo immer noch. Das ist das Bewundernswerte bei seinen singulären Paganini-Variationen, dass bei diesen haarsträubenden Schwierigkeiten der Flügel stets wunderbar klingt, egal wie "laut" es wird. Selbst bei Richter wird es dagegen bei diesem Stück im Forte bisweilen auch schon häßlich - das Instrument ächzt und stöhnt bei diesen Forte-Massen, während bei ABM der Flügel nie "schwitzen" muß. Bei Gilels klingt der Flügel trotz der Riesendynamik im Fortissimo auch nie hohl und scharf. Denn er setzt zwar das Argewicht ein, schafft es aber, den Druck in der Fingerkuppe zu bündeln, d.h. der Ton wird so eben nicht von oben in die Tasten "gestoßen" - dann scheppert nämlich der Flügel oder der Ton ist gar ganz weg. (Für unschönes Forte gibt es ja eine illustre Reihe von Klaviergrößen: Gawrilow, Korstick usw. usw.  )
)Die sehr schönen Lupu-Aufnahmen werde ich mir wohl endlich mal besorgen müssen. Eine ideale Aufnahme der Sonate op. 5 ist für mich immer Artur Rubinstein (RCA 1959 aus der Stereo-Frühzeit) gewesen. Da stimmt einfach schlechterdings alles: Die Interpretation, die Klangästhetik und die Aufnahmetechnik. Eine der wirklich ganz großen Aufnahmen "für die Ewigkeit".

Herzlich grüßend
Holger -
Ich habe gerade nochmals nachgehört - den Beethoven mit dem Brahms verglichen.
Die Sonaten op. 7 sowie die "Appassionata" hatte ich in den entsprechenden Threads schon gesprochen. Dazu habe ich heute noch dazu in op. 22 und die Waldstein-Sonate reingehört. Was ich über op. 7 schrieb (die Rezension stelle ich am Schluß hier nochmals ein), hat sich auch beim Wiederhören op. 22 und der Waldsteinsonate bestätigt. Die Tontechniker haben reichlich viel Hall dazugemixt. (Hier in meiner neuen Wohnung macht sich das noch störender bemerkbar als in der alten - ich habe durch die Rigipswände einen spürbaren Dämpfungseffekt.) Das kann nicht der natürliche Halleffekt sein, denn der Brahms wurde im selben Saal aufgenommen und da ist kein solcher zu hören. Und dieser Hall ist leider sehr unvorteilhaft für das Klangbild. Es entsteht bisweilen ein sehr verwaschener Klang - sehr schade! Das Finale der Waldsteinsonate ist wirklich sehr furios-mitreißend gespielt (das muß ich noch wenn ich demnächst Zeit habe ganz durchhören und besprechen!), leider säuft der Flügel bei dieser Tontechnik fast ab. Auch bei op. 22 (der Kopfsatz ist wirklich sehr souverän gespielt und auch durchaus klangschön) verwässert die Tontechnik das Ganze. Am besten aufgenommen ist die Appassionata - da ist deutlich weniger Hall zu spüren aber es ist auch nicht lärmig. Da gibt es kaum etwas herumzumäkeln - andere Aufnahmen sind da technisch eher schlechter.
Man fragt sich: Warum ist die Tontechnik nur so verfahren? Die Antwort ist vielleich die Brahms-Aufnahme. Die ist viel "realistischer" und substanzieller, aber von einer Schärfe, die einfach nur nervt. Der Beginn der Schumann-Variationen hört sich noch sehr passabel an (ist auch sehr gut gespielt um es deutlich zu sagen!) - aber der Walzer op. 39 Nr. 1 nervt schon extrem. Da klingt der Flügel wirklich wie eine Blechbüchse. Das kann man kaum aushalten. Ebenfalls ziemlich unerträglich ist das Forte des Scherzo aus der Sonate op. 5. Dazu klingt der Flügel noch topfig in den Mitten und Bässen - das erinnert fast an einen Hammerflügel oder Wohnzimmerklavier-Akustik. Ich nehme an, die Tontechniker wollten diese Schärfe bei den Beethoven-Aufnahmen vermeiden, sind mit den Mikrophonen etwas weiter weg gegangen vom Instrument und haben dazu noch ordentlich Hall zugemischt, um die indirekten Schallanteile zu erhöhen und das Forte erträglicher zu gestalten. Nur haben sie leider oft die Suppe mit dieser Zutat einfach überwürzt.
Der Hall kann zum heiklen Punkt einer Aufnahme werden. Mein Lehrer spielte in Düsseldorf in einem Saal, der praktisch null Hallanteile hat. Schon live ist das ein Kunststück, mit dieser Akustik klarzukommen. Die noch unveröffentlichten Aufnahmen, die er dort machte, hat er mir vorgespielt vom Band: Über Lautsprecher geht das gar nicht, das kann man so pulvertrocken wie das klingt keinem CD-Hörer zumuten. Also muß der Tontechniker, der solche Maßnahmen eigentlich aus Prinzip ablehnt, da doch etwas Hall zumixen. Im Fall von Opitz wäre es also interessant, den Flügel in dem Saal live zu hören. Dann erkennt man das Problem und könnte Fundierteres dazu sagen.
Den Vergleich der Aufnahme der Schumann-Variationen mit Katchen werde noch nachliefern.
Hier meine Rezension von op. 7 vom letzten Jahr (welche auch eine Bestätigung für Eindrücke von Thomas ist


Buchbinders deutscher Kollege Gerhard Oppitz entpuppt sich in der Interpretation von op. 7 als dessen Antipode. Zeigt Buchbinder im Kopfsatz zuviel Eigenwilligkeit, so Oppitz eher zu wenig. Vorweg ist zu sagen, dass die Tontechniker etwas zu viel Hall zugemischt haben, wodurch die vielleicht nur leichte Schwäche einer gewissen Glätte eine nicht unerhebliche Verstärkung erfährt. Gleich zu Beginn macht sich dies bemerkbar. Die Einleitung wirkt ähnlich wie bei Claude Frank etwas zu flüssig und in den Formabschnitten zu wenig abgeteilt. Oppitz macht eigentlich alles richtig – nur fehlt eine gewisse Feinzeichnung. Man wünschte sich bisweilen mehr „Widerhaken“ in den Motivbewegungen. In der Reprise wirkt die Einleitung dann doch wohltuend deutlich geordneter. Oppitz – der ja ein Kempff-Schüler ist – spielt immer sehr melodisch „schön“ und organisch. Bei aller Souveränität und Wohlgesetztheit vermisst man aber dann doch ein wenig das persönliche Profil, die Unverwechselbarkeit.
Das Largo beginnt mit schön atmenden Phrasierungen. Der ganze Satz lebt bei Oppitz vom klavieristischen Gesang. So schön das klingt – es ist aber auch nicht betörend aufregend. Das alles ist ungemein schlüssig, ohne Zweifel – die ganz große Ausstrahlung fehlt jedoch. Für meinen Geschmack beginnt das Scherzo einen Tick zu langsam und ein bisschen zu schwerfällig – an diesem Eindruck kann aber auch die zu hallige Aufnahmetechnik Schuld sein. Einnehmend schön ist der sehr melodisch ausgesungene Mittelteil. Der Minore-Teil bleibt im Piano-Bereich, spielt sich also nicht aufdringlich in den Vordergrund wie bei Buchbinder, klingt aber eher kernig als dämonisch gespenstisch. Im abschließenden Rondo merkt man wie nicht anders zu erwarten die Schule von Wilhelm Kempff. Das Thema wird so wahrlich „gesungen“ mit charakteristischem Kopf. Es kommt hier heraus, dass Oppitz jede Art von expressivem Extremismus meidet und den goldenen Mittelweg versucht – also auch allzu viel lyrische Intimität nicht zulassen möchte. So entbehrt das Rondo-Thema bei aller Gesangsfreudigkeit aber auch einer eindeutig expressiven Note, welche über den Schönklang hinausgeht. Warum muss in der Fortissimo-Passage das Tempo angezogen werden? Dadurch wirkt es leicht hastig. Der Ausklang ist schön gestaltet, nur sollten die Vorschläge (die als kurze notiert sind!), weniger „klappern“. Eine insgesamt sehr geschlossene, in jeder Hinsicht untadelige Aufnahme, die in ihrer Unanstößigkeit aber auch ein wenig die ganz große Ausstrahlung fehlt.
Schöne Grüße
Holger -

Diese Orfeo-Aufnahme (ich habe allerdings nur die Hörschnipsel bei jpc gehört) von 1981 - die Gesamtaufnahme ist von 1989, diese ist also 8 Jahre älter - gefällt mir von der Tontechnik her erheblich besser. Obwohl auch da der "direkte" Zugriff von Oppitz zu hören ist, ist der Ton für meinen Geschmack viel poetischer. Da ist Oppitz mal wirklich vorteilhaft aufgenommen. Hier lohnte sich vielleicht wirklich ein Vergleich...

Schöne Grüße
Holger -
Ich meine, dass Brendel einer der Pianisten ist, der aus den gegenüber den "Supervirtuosen" (aktuell vertreten etwa durch Hamelin) doch endlichen virtuosen Fähigkeiten eine Tugend macht. Genau dadurch bringt er Seiten an Liszt hervor, die bei anderen verschwinden, weil bei ihnen Virtuosität doch gern einmal zum Selbstzweck wird.
Lieber Jörn,
genau das finde ich auch! Allzu lange wurde der Komponist Liszt hinter dem Virtuosen versteckt...
Wir könnten nun entweder mit dem zweiten Band fortfahren oder Nachträge zu Band 1 nehmen (ich hätte ein paar im Angebot, etwa Oberman von Aimard oder Volodos). Ganz wie Du magst. Aber vielleicht wäre es interessant, sich zunächst wieder vollständigen Zyklen zu widmen und dann auch immer einmal wieder zusätzliche Einzelaufnahmen einzustreuen.
Wegen der mir bevorstehenden Reise nach Bulgarien, durch die eine Unterbechung entstehen wird, würde ich vorschlagen, dass wir in der Tat Vallee d´Oberman mit Aimard und Volodos machen (Lugansky habe ich auch noch). Danach, nach meiner Rückkehr, fahren wir vielleicht tatsächlich mit Band 2 fort. Ich glaube, das bietet sich an - mit Band 1 haben wir uns wohl ausgiebig genug (wenn natürlich auch längst nicht erschöpfend) beschäftigt und der 2. Band ist nun wahrlich faszinierend mit seinen Bezügen auf die bildende Kunst. Da hätte ich schon große Lust dazu! Weitere Nachträge lassen sich natürlich immer noch einstreuen! Was meinst Du?

Herzlich grüßend
Holger -
Lieber Thomas,
besten Dank! Das höre ich mir bei Youtube an!

Herzlich grüßend
Holger -
aufgrund Deiner Anmerkungen habe ich die Brahms-Aufnahmen ausdem Regal geholt. Vorab: da ich die CD's sofort nach Erscheinen gekauft hatte, habe ich die Ariola-Eurodisc-CD's. Ob bei den Nachpressungen unter anderen Labeln am Klang gefeilt wurde kann ich Dir nicht sagen. Eine mehr oder weniger frühe DDD-Aufnahme, denen damals noch ADD vorzuziehen war.
Um zu vergleichen springe ich jetzt mal zu den Schumann-Variationen. Und lege Julius Katchen daneben. Und es offenbaren sich die Unterschiede jenseits der Aufnahmetechnik. Die zeichnet den Katchen zwar weicher als es die Technik bei Oppitz tut. Aber Katchen spielt das Werk auch versonnener als Oppitz. Gerhard Oppitz geht gemessenen Schrittes durch das Thema, während Katchen fein moduliert und eine ganz andere Grundstimmung erzeugt. Oppitz sachlich kühl vs. Katchen emotional-tiefsinnig, so würde ich die Unterschied beschreiben. Und das scheint mir nicht allein der Aufnahmetechnik geschuldet zu sein (wenngleich das Klavier schon sehr direkt aufgenommen wurde).
Scheint mir bei Oppitz aber damals auch ein wenig von der Tagesform abzuhängen: die live-Auftritte in der Kölner Philharmonie klangen anders als die CD-Aufnahmen. Zuletzt habe ich ihn in Dortmund mit dem 5. KK von Ludwig van Beethoven gehört. Und fand ihn auch da eher sachlich. Wer meine Liebe zum Klavierspiel von Ciccolini, Francois oder auch Kempff kennt kann sich unschwer vorstellen, dass ich mich mit diesem Übermass an Sachlichkeit nicht wirklich anfreunden kann. Liegt aber nicht an Oppitz, das liegt an mir.
Lieber Thomas,dieser Oppitz-Box verdanke ich die Entdeckung der Schumann-Variationen - ein wunderbares Stück, das ich bis dahin gar nicht kannte!
 Was Du als "sachlich" bezeichnest trifft glaube ich den Stil von Oppitz sehr gut. Leider kann ich den Vergleich mit Katchen nicht machen - ich habe nämlich die Decca-Katchen-Box, wo der Brahms nicht komplett drin ist. Katchens Schumann-Variationen fehlen mir so leider!
Was Du als "sachlich" bezeichnest trifft glaube ich den Stil von Oppitz sehr gut. Leider kann ich den Vergleich mit Katchen nicht machen - ich habe nämlich die Decca-Katchen-Box, wo der Brahms nicht komplett drin ist. Katchens Schumann-Variationen fehlen mir so leider!Herzlich grüßend
Holger -
Oppitz war der Lieblingsschüler von Wilhelm Kempf und hat mit ihm vor allem Beethoven erarbeitet. Selbstverständlich, dass dann "Lehrer" und "Schüler" die deutsche Pianistenschule vertreten und gepflegt haben. Klarer packender Zugriff, bei selbstverständlicher technischer Souveränität.
Terchnisch souverän war Kempff eigentlich nie (mein Lehrer sagte immer zur Kempff-Technik: "genial gepfuscht"
 ) - und sein Spiel war weniger packend im Zugriff als von gesanglicher Flexibilität bestimmt. Rein Klaviertechnisch ist Oppitz seinem Lehrer deutlich überlegen - aber weit schöner den Brahms ausgesungen hat wiederum eindeutig Kempff.
) - und sein Spiel war weniger packend im Zugriff als von gesanglicher Flexibilität bestimmt. Rein Klaviertechnisch ist Oppitz seinem Lehrer deutlich überlegen - aber weit schöner den Brahms ausgesungen hat wiederum eindeutig Kempff.Das sind die Vorteile dieses Beethovens-Spiel. Wer andere Auffassungen erwartet wird vielleicht bei anderen Pianisten eher fündig. Bitte jedoch zu bedenken über welche Spitzenpianisten wir jetzt diskutieren. M. E. muss sich die jüngere jetzt marketingmäßig stärker unterstützte Pianistengeneration gewaltig anstrengen, um dieses Niveau zu erreichen und über Jahrzehnte zu halten.
Ich mag ja keine pauschalen Urteile über Pianisten (Lobeshymnen ausgeschlossen). Die Qualität von Oppitz ist natürlich unbestreitbar. Einige seiner Beethoven-Aufnahmen habe ich auch noch vor zu besprechen. Die beste Strategie ist immer, die gelungenen Aufnahmen vorzustellen. Dann kann man über die schwächeren ruhig hinwegsehen.

Schöne Grüße
Holger -
-
Meine mit Abstand beste rein pianistische Brahms-CD hat Radu Lupu bei Decca eingespielt. Diese Aufnahme hat bei mir einen ähnlich singulären Stellenwert wie die ebenfalls unerreichte Grieg CD des Emil Gilels....
Welche meinst Du, lieber Glockenton?Bei Brahms 1. bei mir ganz oben Gilels, Arrau, Rubinstein. Pollini gefällt mir aucn mit Abbado besser als mit Thielemann.

P.S. Ashkenazy/Haitink mit dem volltönenden Concertgebouw Orkest ist auch wirklich sehr gut - die Aufnahmen muß ich mir endlich mal kaufen....

Herzlich grüßend
Holger -
Es geht mir nicht um einen Interpretationsvergleich, lieber Holger, sondern um die Frage, die weiter oben angeschnitten wurde, ob eine Aufnahme tatsächlich so schlecht aufgenommen wurde, dass die o. a. Fehler auftreten. Und ich meine, dass an der von mir geposteten Aufnahme doch alles in Ordnung ist. Damit will ich kein Wort über die Intepretation sagen, weil ich da überhaupt nicht in dem Thema stecke.
Das verstehe ich, lieber Willi! Diese Filmaufnahme ist aber wohl nicht identisch mit der CD. Wie man aber unschwer erkennen kann, ist das Spiel von Oppitz im Vergleich mit einem Fiorentino eher "robust". Eine gute Aufnahmetechnik sollte das berücksichtigen. Ein anderes Beispiel: Alexis Weissenberg hatte eine immense Dynamikspanne. Es gibt zwei Aufnahmen von Chopins Trauermarschsonate aus dem selben Saal in Paris, kurz hintereinander gemacht, eine für RCA und eine für EMI. Die EMI-Aufnahme klingt einfach unangenehm hart - ganz anders als die von RCA. Da sind die Tontechniker im einen Fall mit Weissenbergs Kraftakten nicht fertig geworden. Die Tontechniker damals hätten bei Oppitz vielleicht gut daran getan, den Flügel nicht so präsent aufzunehmen, damit das Forte nicht so bissig rüberkommt.Herzlich grüßend
Holger -
... und zum Vergleich, lieber Willi, Sergio Fiorentino
 - eine Aufnahmetechnik an der Grenze zum Erträglichen. Aber was für eine Eleganz und ein schöner Klavierton (sehr schade, dass es die Händel-Variationen mit ihm nicht auf CD gibt!)! Da vergißt man alle technischen Mängel und lauscht nur diesem wunderbaren Vortrag:
- eine Aufnahmetechnik an der Grenze zum Erträglichen. Aber was für eine Eleganz und ein schöner Klavierton (sehr schade, dass es die Händel-Variationen mit ihm nicht auf CD gibt!)! Da vergißt man alle technischen Mängel und lauscht nur diesem wunderbaren Vortrag:Liebe Grüße
Holger -
Die Brahms-Solo-Aufnahmen sind auch in Reitstadel (Oberpfalz) gemacht - stammen allerdings von 1989, sind also schon etwas betagt. Oppitz war zu der Zeit 36 Jahre alt. Es gibt Pianisten, die sich ausgiebig um ihre Aufnahmen kümmern einschließlich der Intonation des Flügels (Beispiel: Krystian Zimerman, der die Bänder sogar selber schneiden will, weswegen sein vor ca. 20 Jahren aufgenommener Schubert immer noch nicht erschienen ist
 ), und andere, denen sogar die Auswahl und Intonation des Flügels lästig und im Prinzip egal ist. So jemand war Svjatoslav Richter - er hat tatsächlich auf jeder "Gurke" von Instrument, das man ihm vorsetzte, gespielt. (Zum Glück kam dann irgendwann Yamaha...) Die Klangästhetik einer Aufnahme kann die Vorteile und auch gewisse Schwächen der Interpretation mehr oder weniger unterstreichen. Der Arrau-Biograph Josef Horowitz z.B. meinte, dass Arraus Philips-Aufnahmen der Beethoven-Sonaten unvorteilhaft seien, die Vorzüge seines Spiels, die man im Konzert erleben kann, gar nicht wiedergeben würden. Ich habe Oppitz in der Bielefelder Oetker-Halle mit dem Reger-Konzert gehört und konnte ihm auch auf die Finger schauen. Er hat eine eigentlich vorbildliche, sehr ergonomische Fingertechnik und der Flügel klang nie irgendwie hart oder scharf. Pianisten, welche den Flügel "martern", erkennt man immer auch an der Art, wie sie die Finger bewegen, wie sie das Armgewicht einsetzen usw. Das war bei Oppitz einfach nicht der Fall. Bei der Brahms-Aufnahme muß ich aber schlicht konstatieren: Ich habe noch nie einen Bösendorfer - der doch eigentlich eher tonschön und rund klingt - so harsch aufgenommen gehört. Und Oppitz´ sehr direkte, etwas nüchterne und weniger hintergründige Spielweise wird durch den harschen Klang dieser Aufnahme in einer Weise verstärkt, dass so ein Brahms-Spiel dann doch sehr "prosaisch" wirkt. Ich muß allerdings sagen, dass ich auch einige teilweise schlecht und sehr schlecht aufgenommene Mitschnitte anderer Pianistengrößen habe, wo es der Aufnahmetechnik, die wahrlich zum Heulen ist, nicht gelingt, die ästhetische Qualtität des Klavierspiels zu zerstören. Man kann somit meine ich die Schwächen dieser Aufnahme nicht ausschließlich auf die Aufnahmetechnik schieben.
), und andere, denen sogar die Auswahl und Intonation des Flügels lästig und im Prinzip egal ist. So jemand war Svjatoslav Richter - er hat tatsächlich auf jeder "Gurke" von Instrument, das man ihm vorsetzte, gespielt. (Zum Glück kam dann irgendwann Yamaha...) Die Klangästhetik einer Aufnahme kann die Vorteile und auch gewisse Schwächen der Interpretation mehr oder weniger unterstreichen. Der Arrau-Biograph Josef Horowitz z.B. meinte, dass Arraus Philips-Aufnahmen der Beethoven-Sonaten unvorteilhaft seien, die Vorzüge seines Spiels, die man im Konzert erleben kann, gar nicht wiedergeben würden. Ich habe Oppitz in der Bielefelder Oetker-Halle mit dem Reger-Konzert gehört und konnte ihm auch auf die Finger schauen. Er hat eine eigentlich vorbildliche, sehr ergonomische Fingertechnik und der Flügel klang nie irgendwie hart oder scharf. Pianisten, welche den Flügel "martern", erkennt man immer auch an der Art, wie sie die Finger bewegen, wie sie das Armgewicht einsetzen usw. Das war bei Oppitz einfach nicht der Fall. Bei der Brahms-Aufnahme muß ich aber schlicht konstatieren: Ich habe noch nie einen Bösendorfer - der doch eigentlich eher tonschön und rund klingt - so harsch aufgenommen gehört. Und Oppitz´ sehr direkte, etwas nüchterne und weniger hintergründige Spielweise wird durch den harschen Klang dieser Aufnahme in einer Weise verstärkt, dass so ein Brahms-Spiel dann doch sehr "prosaisch" wirkt. Ich muß allerdings sagen, dass ich auch einige teilweise schlecht und sehr schlecht aufgenommene Mitschnitte anderer Pianistengrößen habe, wo es der Aufnahmetechnik, die wahrlich zum Heulen ist, nicht gelingt, die ästhetische Qualtität des Klavierspiels zu zerstören. Man kann somit meine ich die Schwächen dieser Aufnahme nicht ausschließlich auf die Aufnahmetechnik schieben.Schöne Grüße
Holger -
Das war eine der allerersten, wenn nicht sogar vielleicht die erste Klavierplatte, die ich als Student gekauft habe. Ich bin also - wie Du an anderer Stelle heute schon empfohlen hast - ganz oben eingestiegen.

Ich hatte nie das Bedürfnis, eine weitere Aufnahme zu besitzen, die von Katchen ist dann im Rahmen der GA dazugekommen. Ich habe die Aufnahme mit Arrau gerade noch einmal gehört. Einfach wunderbar.Zum Thema: ich hatte vor vielleicht zwei Jahren eine der Beethoven-Sonaten-CDs mit Oppitz gekauft und war ebenfalls entsetzt über den Klang des Flügels. Ich konnte darob die Interpretation gar nicht weiter würdigen.
Das freut mich, lieber Lutz, dass ich mit meinen Hörvorlieben doch nicht alleine bin - und offenbar auch in Bezug auf Oppitz´ nicht berauschendem Flügelklang Bestätigung erfahre!

Herzlich grüßend
Holger -

Zunächst einige pianistische „Absonderlichkeiten“, die einem beim konzentrierten Nachhören auffallen. Cord Garben meinte, Michelangeli gebühre der erste Platz, wenn es um die Pianistenmanier gehe, die Akkorde zu brechen, zeitversetzt zu spielen. Ich glaube, da irrt sich Garben, dieser Ehrenplatz gebührt eindeutig Alfred Brendel. Es „klappert“ bei ihm nur so wie ein Mühlrad – schon in „Eglogue (Hirtenweise)“. In „Le mal du pays“ liegt es nicht zuletzt auch an Liszts sperrigem Klaviersatz. Da sind z.B. im Bass Dezimengriffe notiert, die Brendel mit seinen Händen wohl nicht greifen kann. Man kann sich hier aber (z.B. Takt 23) bequem helfen, indem man das Gis (Dezime E-Gis im Bass) mit der rechten und nicht der linken Hand spielt. Aber Meister Brendel mag offenbar das „Klappern“, kostet es genüsslich aus. Das Thema – unisono eigentlich – wird in der Wiederholung (Takt 3-5) ganz leise als Oktave gespielt. Auch in „Les cloches de Genève“ gibt es so kleine, kaum merkliche Veränderungen. Brendel schmuggelt in die Arpeggien zu Beginn einen dritten Füllton ein, so dass sie zum sonoren Glocken-Dreiklang werden.
Die Hirtenweise nimmt er wirklich „Allegretto con moto“ – mit der Frische des Morgens nach der Nacht der Skepsis und selbstzerstörerischer Selbstzweifel. Man hört fast einen Schubertschen, munteren Marschrhythmus heraus. Das finde ich insgesamt sehr gelungen, wenn auch die Piano-Forte-Kontraste etwas dynamisch eingeebnet werden. „Le mal du pays“ gefällt mir auch in Brendels passioniertem Engagement. Das Forte des Themas ist mir ein wenig zu knallig und zu wenig grüblerisch. Das „Andantino“ Takt 11 hätte er vielleicht im Charakter etwas deutlicher absetzen können. Im Vergleich mit Bermans grandioser expressiver Schlichtheit ist das etwas „rhetorischer“ und rhapsodischer – aber bei dieser Thematik ohne Frage passend. Man kann es eben so auch machen. „Les cloches de Genève“ ist zweifellos hochkultiviert gespielt, mir aber insgesamt etwas zu dramatisch-affektiert und rhapsodisch-virtuos – da werden z.B. die Harfen-Arpeggien „frisiert“, in romantischer Virtuosen-Manier beschleunigt. Der Ausklang ist ja eigentlich die hymnisch ausgelassene und nicht dramatisch angespannte Einkehr in den Hafen der Liebe – in Genf lebt Liszts damalige Geliebte Marie d´Agoult. Auch kommt der dynamische Höhepunkt im Fortissimo (Takt 108 ff.) nicht so heraus. Im Grunde ist das aber Mäkeln auf sehr hohem Niveau. Alles in allem ist das, was Brendel macht, sehr überzeugend. Eine ganz „persönliche“ Sicht von Liszt, wie man es von einem wirklich bedeutenden Liszt-Interpreten wie ihm auch erwartet.
Fragt sich also, lieber Jörn - wie machen wir weiter!

Herzlich grüßend
Holger -

Diese Box hatte ich mir einst zugelegt, um Brahms´ Klavierwerke komplett zu haben. Eine gute Wahl dachte ich, bei dem Namen, den Oppitz hat. Vor Jahren war ich beim Reinhören doch enttäuscht. Die Balladen op. 10 sind schlicht interpretatorisch und klangästhetisch ein Totalausfall - selbst Barenboims mißlungene Aufnahme ist da noch "besser". Also habe ich heute die Eindrücke aufgefrischt und erst die Klavierstücke op. 119 und dann die Händel-Variationen gehört - eines der für mich schönsten Klavierzyklen überhaupt. Auch beim Wiederhören bestätigt sich mein erster Eindruck: Mit diesem Oppitz-Brahms kann ich mich gar nicht anfreunden. Die Schwierigkeit bei Brahms besteht darin, die Balance zu finden zwischen Leidenschaft und klassischer Abgeklärtheit, zwischen Wucht und Intimität, Kernigkeit und einem Feinsinn, der nie verzärtelt sowie einem vollen, schönen Ton, der zwischen Direktheit und romantischem Geheimnis balanciert - einem vitalen Musikantentum mit Tiefe als Hintergrund. Arrau, Rubinstein, Michelangeli, Katchen, Gilels oder auch Fiorentino - ihnen gelingt dieser Balanceakt. Oppitz´ Brahms hat Kraft und Wucht - aber ist auch sehr "deutsch", positivistisch-musikantisch mit einem oft einfach lärmenden Ton (der Flügel (Bösendorfer) ist alles andere als ideal intoniert!). Bei den wunderbaren Händel-Variationen gibt es - was selten aber doch vorkommt - eine "ideale" Aufnahme, welche das Prädikat "Jahrhundertaufnahme" verdient. Das ist Claudio Arrau (Philips). Bei Oppitz klingt das alles dermaßen positivistisch-vordergründig, dass die Musik jegliche Aura und jedes Geheimnis verliert. Der so typische, dunkle, schön-schillernde Brahms-Ton - er ist bei Oppitz nicht zu hören. Die ideale Balance - sie ist da einfach nicht getroffen.
Schöne Grüße
Holger -
Wenn über Brahms diskutiert wird, sollte meines Erachtens Gerhard Oppitz keinesfalls vergessen werden. Seine Gesamteinspielung des gesamten Klavierwerks von Johannes Brahms hat höchsten Rang und genießt international höchste Anerkennung. Die Fachpresse gibt dem deutschen Pianisten Oppitz den Ritterschlag indem sie ihn in den Rang des legendären Brahmspianisten Julius Katchen erhebt.
Ich habe Opitz in Bielefeld mit dem Reger-Konzert erlebt - das war grandios! Das Brahms-Konzert habe ich leider wegen Umzugs verpaßt. Die Gesamteinspielung der Brahms-Klavierwerke besitze ich ebenfalls. Allerdings bin ich streckenweise reichlich enttäuscht. Ich habe wirklich nicht geglaubt, dass man die Balladen op. 10 noch schlechter als Barenboim spielen kann - Oppitz beweist es (leider). Auch die Paganini-Variationen sind schrecklich - nicht zuletzt klingt der Bösendorfer-Flügel im Diskant einfach fürchterlich. Insofern scheint mir der Vergleich mit Julius Katchen doch ein wenig kühn....
Auch die Paganini-Variationen sind schrecklich - nicht zuletzt klingt der Bösendorfer-Flügel im Diskant einfach fürchterlich. Insofern scheint mir der Vergleich mit Julius Katchen doch ein wenig kühn....Schöne Grüße
Holger



