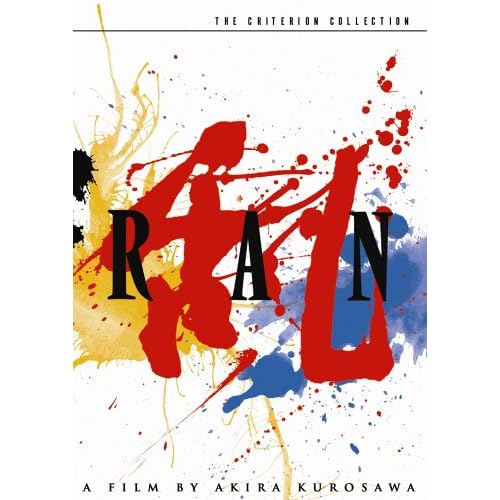Kann natürlich sein, daß ich ganz doof bin (  ), aber beides sind IMHO keine Alternativszenarien im echten Sinne...
), aber beides sind IMHO keine Alternativszenarien im echten Sinne...
Dann hätte Szenario 1 so weitergehen müssen:
Nach Hanslicks vernichtender Kritik an seiner Methode entschuldigte sich Schönberg damit, es sei ja bloß mal ein Versuch gewesen, der allerdings gescheitert sei. Er werde fortan nur noch gefällige Filmmusik schreiben, da der Film die Kunst der Zukunft sei. Daraufhin änderte er seinen Namen in Nino Rota und wurde in Hollywood berühmt. Von der ZTT hörte man nie wieder etwas, sie fiel der verdienten Vergessenheit anheim. Ein späterer Versuch des französischen Musikdilletanten Pierre Bulette, sie wieder zu beleben scheiterte, als bei einer Aufführung alle Musiker anfingen zu lachen und nicht mehr weiterspielen konnten. O-Ton Bulette: "Es geht tatsächlich nicht, Richard Strauss hat recht."
Szenario 2:
Daraufhin verbot der regierende Kaiser Franz das DMS. Alle Kompositionen erklangen in der neuen, von Beethoven entwickelten Technik. Der Maestro selbst legte zB sein Werk "Gesang der Jünglinge" und "27'38" vor, bekam den Großen Österreichischen Staatspreis für Musik und wurde Honorarprofessor für Neue Musik an der Uni Wien (aus Steuermitteln finanziert). Dort rief er ein Institut für Neue Musik ins Leben (aus Steuermitteln finanziert) und zog mit Stipendien viele junge Komponisten heran (aus Steuermitteln finanziert), lobte Preise für innovative Neue Musik aus (aus Steuermitteln finanziert) und ließ zahlreiche Werke drucken (mit Subventionen für den Verleger, aus Steuermitteln finanziert).
Alle Musik mußte außerdem - eine weitere bahnbrechende Idee von Maestro Beethoven - ökologisch einwandfrei und klimaneutral erklingen. Opernhäuser und Konzerthallen wurden durch erneuerbare Energie beheizt, Petroleumlampen verboten. Das Publikum durfte nicht mehr in Frack und Abendkleid erscheinen, sondern trug nur noch aus Hanf gewonnene einfache Kleidung.
Musikinstrumente wurden ausschließlich aus recyceltem Material hergestellt, die Notenblättern beidseitig beschrieben. Gelegentlich kam es dabei zu Verwechslungen der richtigen Seiten, aber das konnte das Publikum ohnehin nicht mehr unterscheiden.
Auf Eintrittskarten, Musikintrumente und dergl. wurde ein Pfand erhoben. Alle der Musik dienenden Gegenstände mußten an besonderen Sammelstellen (aus Steuermitteln finanziert) abgegeben werden.
Die Erwähnung der herkömmlichen Musik wurde verboten und unter Strafe gestellt. Wer den musikalischen Fortschritt durch Maestro Beethovens Neue Musik bezweifelte, wurde als "Musikleugner" gesellschaftlich geächtet und verlor seine Stellung.
Zur Überwachung aller dieser Maßnahmen wurde ein Ministerium für Umwelt und Musik geschaffen, mit Beethoven als Minister, Ries als parlamentarischem Staatssekretär, und etwa 10.000 Mitarbeitern (aus Steuermitteln finanziert).
Die Musik, wie man sie vorher kannte, ging in den Untergrund und konnte nur noch heimlich gehört werden. Wer dabei erwischt wurde, diese Musik zu spielen oder zu hören, kam in eine Umerziehungseinrichtung (aus Steuermitteln finanziert). Komponisten, die sich weigerten, den musikalischen Fortschritt anzuerkennen, konnten nur geisteskrank sein und kamen in psychiatrische Behandlung (aus Steuermitteln finanziert).
Bekannte "Musikleugner" waren zB Robert Schumann, Frederic Chopin, Hector Berlioz oder Richard Wagner, die ihr zweifellos vorhandenes musikalisches Talent leider an die falsche Musik verschwendeten und der verdienten Umerziehung zugeführt werden mußten. Nach ihrer Entlassung kamen sie als Musiker in Blasorchestern der Provinz unter, wo sie zT noch heute musizieren, nun aber ökologisch einwandfrei.