Liebe Taminos, liebe Mitleser,
als vor knapp eineinhalb Jahren der Afrikaner Youssou N'Dour mit dem UNESCO-Musikpreis ausgezeichnet wurde, rang mir das zunächst nur ein müdes Lächeln ab, wurde mir doch ein Ereignis in Erinnerung gerufen, welches noch etwas weiter zurückliegt. Damals, 2002, durfte ein neunzigjähriger Professor für Komposition am Moskauer Konservatorium, eine Mozart Medaille der UNESCO für "hervorragenden Beitrag zur Entwicklung der Weltkultur" entgegennehmen. Der schlohweiße Greis mit dem gutmütigen Antlitz zeigte sich sichlich gerührt.
Was den schwarzen Popstar aus dem Senegal ausmacht, sind dessen soziales Engagement, Verdienste um Freiheit, Völkerverständigung und Musik. Gute Ehrungsgründe.
Wofür stand und steht nun Tikhon Khrennikov (Chrennikow)? Als Komponist konservativ, oberflächlich. In Amerika hätte es für eine Broadway-Karriere gereicht, heißt es. Aber auch er brachte ja nicht nur Noten zu Papier, sondern erwies sich in vielfältiger Weise als fleißger Zeitgenosse.
Schon in jungen Jahren verwaltet er die Musikabteilung des Zentralen Theaters der Sowjetarmee. Eine Sternstunde in seinem Leben war jener gesamtsowjetische Komponistenkongress zu Moskau im Jahre 1948. Auf Stalins Geheiß erklärt er dem "Formalismus" offiziell den Krieg. Auf der Schmähliste stehen u.a. Prokofieffs 6. Klaviersonate, Schostakowitschs 8. und 9. Sinfonie ...

Fortan bekleidet Khrennikov mit (damals) lukrativen 5000 Rubel Anfangsgehalt das Amt des Chefs des Komponistenverbandes (das er bis zum offiziellen Ende der SU innehält). Zu seinen Hauptaufgaben gehört die landesweite Propagierung und Durchsetzung vom ZK festgelegter Musikpolitik. Komponisten werden regelmäßig zu künstlerischen Rechenschaftsberichten einbestellt. Khrennikov macht sich aber auch vor Ort kundig, bereist viele entlegene Teile des Riesenreichs. Wessen Schaffen nicht den Vorgaben der Regierung entspricht, läuft Gefahr, als subversives Element erachtet zu werden, was zu Stalinszeiten höchste Alarmstufe bedeutet. Mangels Alternativen (etwa Auswanderung) bleibt nur die Sebstkritik.
Khrennikov, in den Schostakowitsch-Memoaren auch "Bluthund" tituliert, soll ein besonderes Augenmerk auf jene Komponistenkollegen gerichtet haben, die ihm fachlich gefährlich wurden. "Den zerquetschen wir wie eine Wanze" solI er mal während eines Small Talks geflüstert haben, als jemand Schostakowitschs Achte zu lobten wagte.
Wacker hält sich Khrennikov in Wendezeiten, relativiert seine frühere Rhetorik. So sei ihm der Redeauftrag für den Komponistenkongress 1948 vom ZK erst Stunden vorher, ohne Vorbereitungszeit, erteilt worden. Zu jener Ära wäre es unklug gewesen so etwas abzulehnen. Er bezeichnet sich als Opfer der Zeitgeschichte, findet Fürsprecher. Seinetwegen sei niemandem ein Haar gekrümmt worden. Im Gegenteil, sein Engagement hätte vielen Sowjet-Komponisten Arbeit und Brot gesichert.

Die Memoiren eines Mannes mit dem heißen Draht zu Dschugaschwili und dem KGB könnten sicherlich für einigen Wirbel sorgen. Khrennikov hält sich bedeckt. Unversehrtheit und geruhsamer Lebensabend sind ihm heilig, wer will's ihm verdenken. Da plaudert er doch lieber aus dem Nähkästchen eines prinzipientreuen Musikers, dessen Grundpfeiler aus schöner Melodie, Liebe und Bescheidenheit bestehen. Ein zu satter Komponist sei kein guter Komponist, so Khrennikov weise. Auf seine alten Tage präsentiert er ein Notenalbum mit Children's-Pieces (the first kiss, I miss my friend ... ). Wohlgefälliges aus der Feder eines liebenswerten Opas, kinderleicht in der guten Stube vom Blatt zu spielen. Wohltaten im Sinne der reinen Harmonielehre, die selbst des Teufels Schippe erstarren lassen

gaspard









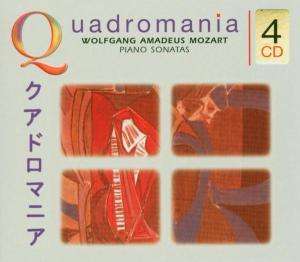


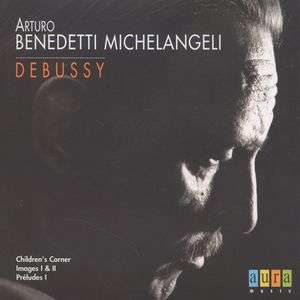
 [i
[i









