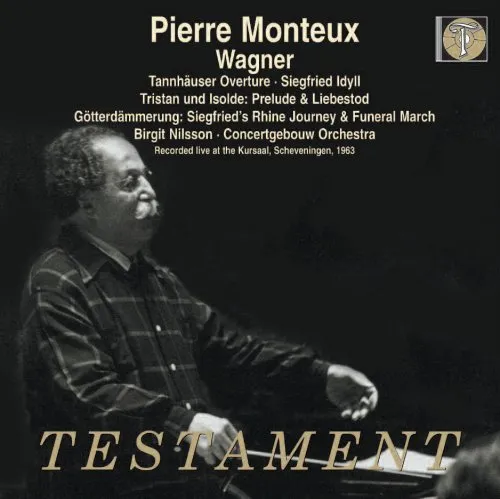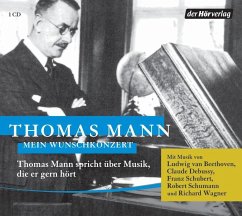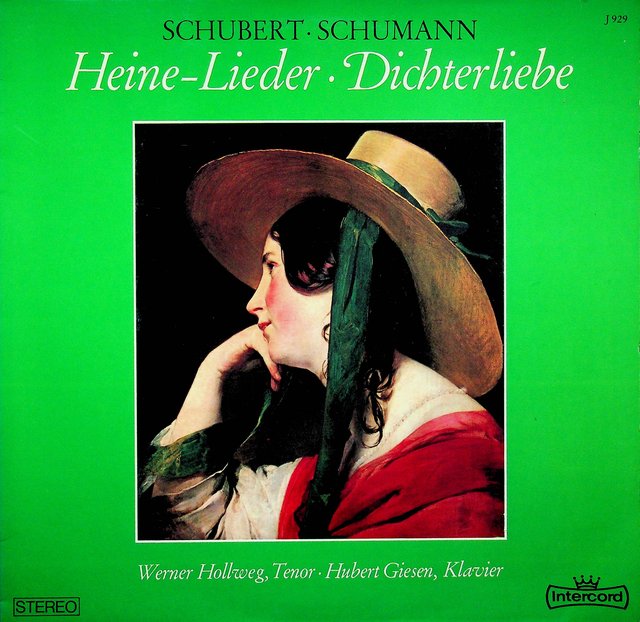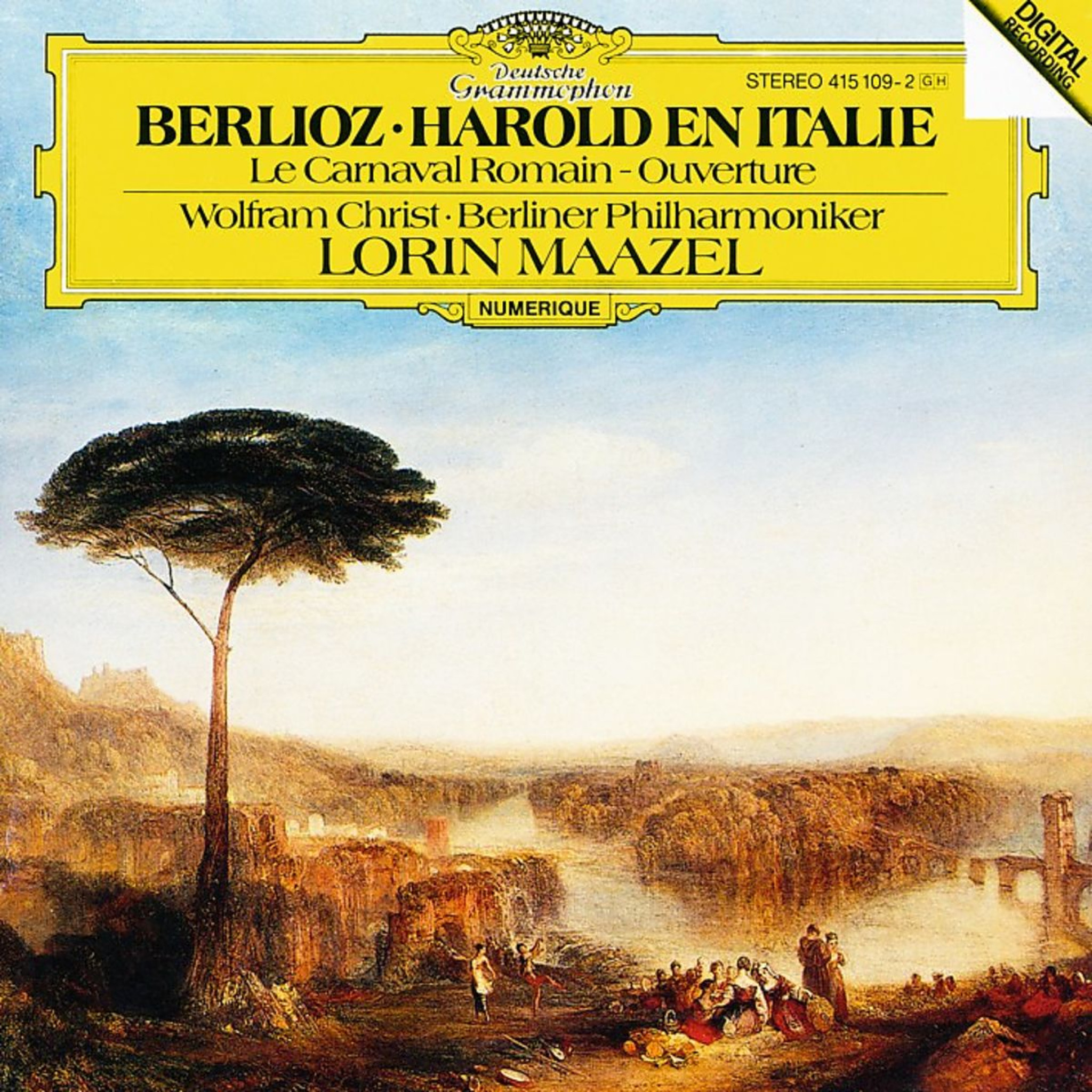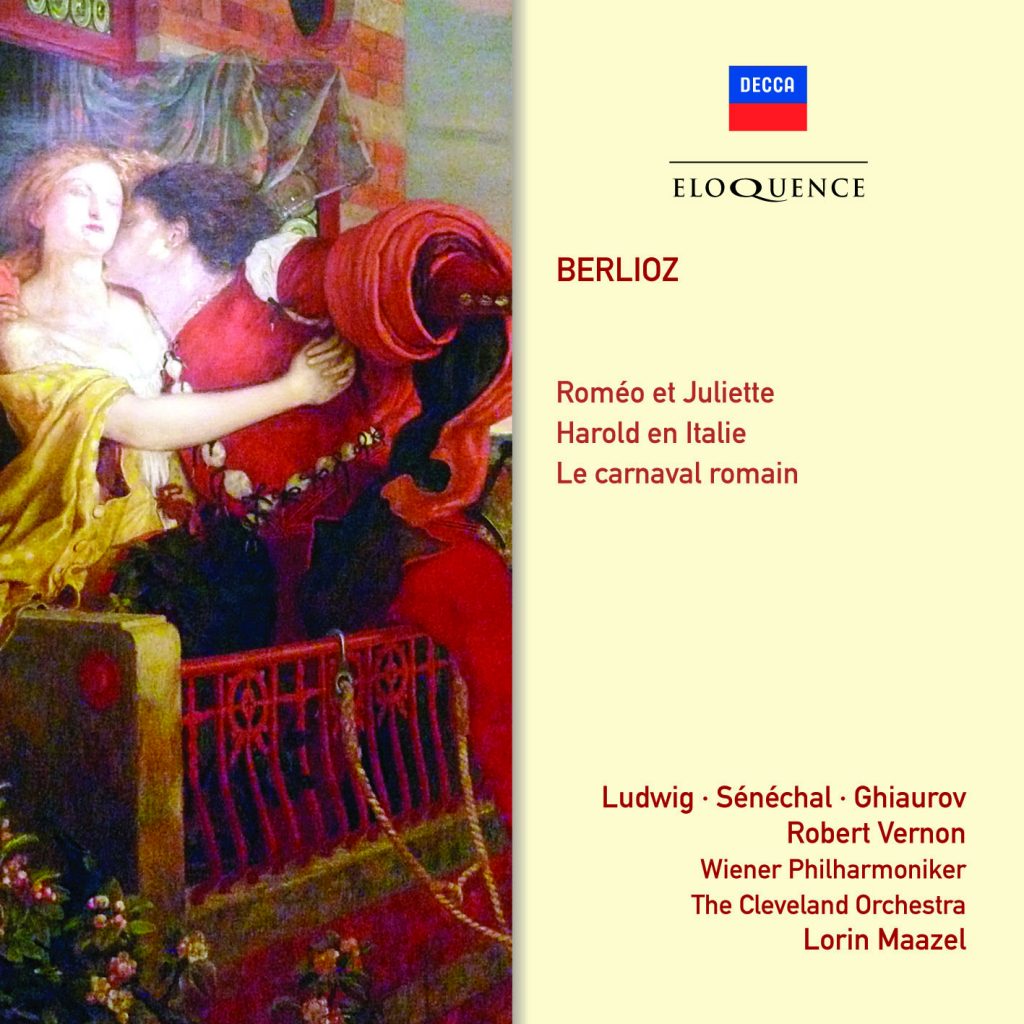Das Label harmonia mundi hat eine CD mit der Schauspielmusik zu Ein Sommernachtstraum herausgegeben.
Max Urlacher als Sprecher begleitet die Handlung. Wer nur die Musik hören möchte, der stört sich vielleicht daran. Das Orchester spielt sehr akzentuiert und hat den Staub von der Partitur gewischt.
Mi-Young Kim (Sopran), Anna Erdmann (Mezzosopran), RIAS Kammerchor, Freiburger Barockorchester, Pablo Heras-Casado
Noch eine "Sommernachtstraum"-Aufnahme? Es gibt doch schon so viele. Wenn man trotzdem gegen die Konkurrenz bestehen will, müssen besondere Einfälle her. Davon haben Heras-Casado mit dem Freiburger Kammerorchester und Urlacher als Sprecher einiges zu bieten - einschließlich laustarke Äußerung eines Esels. Ob aber - wie es moderato bildhaft ausdrückte - "Staub von der Partitur gewischt" wurde? Ich verstehe, was er uns sagen will, würde mich aber anders ausgedrückt haben. Mir ist kaum ein anderes musikalisches Werk bekannt, auf dem sich weniger Staub hätte absetzen können über die Jahre als bei Mendelssohns Schauspielmusik. Es ist sozusagen "staubeschützt" - wie fast der gesamte ewig junge Komponist. So mein Eindruck. Ich frage sich nur, warum das so ist. Während der Naziherrschaft war Mendelssohn - obwohl kein Jude mehr - tabu und damit zugleich auch irgendwie geschützt. Geschützt in dem Sinne, dass er nicht vereinnahmt werden konnte wie beispielsweise Wagner, auf dem sich durch die politischen Umstände in seinem Heimatland ganz Staubschichten abgelagert hatten. Aber das nur am Rande.
Die neue Aufnahme finde ich ziemlich flott. Sie betont das Theaterhafte der Schaupielmusik, was so schlecht nicht ist. Da ich sie von Spotify hörte, weiß ich nicht, ob im Booklet Auskunft über die spezielle Textfassung gegeben wird, die sich von anderen unterscheidet, allein schon dadaurch, dass die Schlussverse unvermittelt in englisch vorgetragen werden. Mendelssohn aber hat seinen "Sommernachtsraum" auf die deutsche Überrsetzung von Schlegel/Tieck komponiert. Es gibt faktisch keine offizielle englische Fassung.