Alban Berg
Lulu-Suite
Margaret Price
Claudio Abbado / London Symphony Orchestra
Ein wenig 20. Jahrhundert zum Abend ist oft nicht verkehrt, um Kopf und Blick zu klären. ![]()
Margaret Price
Claudio Abbado / London Symphony Orchestra
Ein wenig 20. Jahrhundert zum Abend ist oft nicht verkehrt, um Kopf und Blick zu klären. ![]()
Wohlan! Wenn ich sie denn schon gehört und bereits kurz erwähnt hatte, kann ich der Mintz / Sinopoli-Aufnahme auch gleich noch ein paar ausführlichere Sätze widmen, obwohl ich meinen Senf eigentlich zunächst zu einer anderen Einspielung geben wollte. Aber das läuft nicht weg, also:
25:43 - 10:29 - 9:36
Kadenzen: Fritz Kreisler
Das liegt zum einen an Sinopoli und seinem Philharmonia Orchestra, deren Vortrag immer ein Hauch Langeweile zu umwehen, stets das letzte Quentchen Innenspannung zu fehlen scheint, obwohl er temporal zwar eher auf der rechten Spur, durchaus aber noch im Rahmen des Üblichen unterwegs ist.
Zum anderen fühlt sich Shlomo Mintz' Spiel für mich ein klein wenig zu kalkuliert an, zu sehr dem Effekt verpflichtet und nicht wie das Produkt allzu tiefer Empfindung. Da scheint manche Passage ins Rührselige gezogen und mit einem unangenehm schmachtenden Unterton versehen, deren Überbetonung Mintz bei genauem Hinhören stellenweise vergisst, im Nachhinein mittels einer angemessen sorgfältigen Ausformulierung zu rechtfertigen. Oder kurz: er scheint das Gespielte zuweilen nicht tatsächlich so ernst zu meinen, wie er es gern aussehen lässt.
Das ist natürlich alles wie so oft Jammern auf recht hohem Niveau, und womöglich auch meine Exklusiv-Meinung (die Jubel-Arien etwa der Amazon-Kundschaft deuten in diese Richtung), aber unter meinen Favoriten findet sich diese Aufnahme mit Sicherheit nicht.
Verführerisch.... es wäre ca. meine 15.
Dazu spuckte die 'Das könnte Sie auch interessieren'-Spalte noch dieses, wie ich finde auch interessante, Angebot aus:
Tobias Koch - Kleine und / oder obskure Klavierstücke von Beethoven (3 CDs)
...zurückblickend bin ich einer Meinung mit Gombert: alles, was im ersten Satz mehr Zeit beansprucht als 25 Minuten, ist nicht werkgerecht.
Artikulation und Sinn zerfällt zugunsten von romantischem Habitus. [...] An Sinnlichkeit und Schönheit verliert das Werk eher durch das "Auswalzen" der Tempi.
Der zweiten These würde ich glatt zustimmen, die erste lässt sich nach meinem Dafürhalten eher nicht in Granit meißeln.
Gerade heute morgen habe ich mir die als Aufmacher für diesen Thread dienende, im Folgenden aber vernachlässigt gebliebene Einspielung von Mintz / Sinopoli angehört: dieren Kopfsatz kommt mit 25:42 knapp über der magischen Grenze ins Ziel, und in der Tat hatte ich mir eine leichte Trägheit im Vortrag in mein Notizbüchlein geschrieben. Die weiter oben besprochene Szeryng-Aufnahme ist allerdings sogar noch ein paar Sekunden länger, 'funktioniert' für meinen Geschmack aber dennoch ausgezeichnet. Dies liegt an Szeryng selbt, der seinen Vortrag auch ohne irgendwelche Romantizismen mit Sinn zu erfüllen vermag - was Mintz in dem Maße eben nicht gelingt. So zumindest meine Auffassung...
Hallo Tobias,
schön, dass es dich noch gibt. Ich hatte so lange schon nichts mehr von dir gehört, das ich mir schon Sorgen gemacht habe.
Hallo Willi! ![]() Vielen Dank! Ich freue mich auch, daß ich es mal wieder geschafft habe, hier vorbeizugucken. Grund zur Sorge ist keiner gegeben: ich bin und war wohlauf, nur leider eben nicht hier. Die Vielzahl der üblichen anderen Haupt- und Nebensächlichkeiten hat mich mal wieder ferngehalten...
Vielen Dank! Ich freue mich auch, daß ich es mal wieder geschafft habe, hier vorbeizugucken. Grund zur Sorge ist keiner gegeben: ich bin und war wohlauf, nur leider eben nicht hier. Die Vielzahl der üblichen anderen Haupt- und Nebensächlichkeiten hat mich mal wieder ferngehalten...
Ich habe mir nach längerer Zeit mal wieder etwas Vinyl gegönnt:
Maurizio Pollini
Ludwig van Beethoven: Sonaten Opp. 31/2 / 53 / 79 / 81a - "Der Sturm / Waldstein / Les Adieux" / LP
Meine Lieblingssonate (Der Sturm) von meinem Lieblingskomponisten in meiner Lieblingseinspielung von meinem Lieblingspianisten: das rechtfertigt schonmal die Anschaffung einer edlen alten Vinylscheibe - zumal ebendiese Aufnahme in der Gesamtausgabe von Pollinis Beethoven-Sonatenzyklus zugunsten der 2014er-Interpretation keine Berücksichtigung mehr gefunden hat. Wie ich allerdings feststellen musste, ist gerade diese Scheibe (im Gegensatz zu den davor erschienen Pollini-Aufnahmen) mittlerweile nur noch mit Einigem an Geduld zu einem akzeptablen Preis auffindbar. Umso glücklicher bin ich, daß es nunmehr geklappt hat!
Hans Knappertsbusch / Münchener Philharmoniker
Anton Bruckner: Sinfonie Nr. 8 C-Moll / 2-LP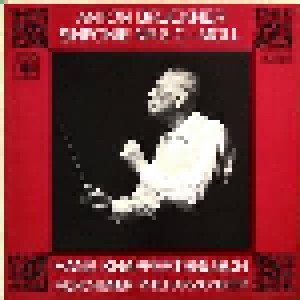
Diese Scheibe habe ich eigentlich gekauft, um mir anzuhören, wie der Sohn meiner derzeitigen Heimatstadt Knappertsbusch eine meiner Lieblingssinfonien interpretiert. Quasi als Sahnehäubchen habe ich mittlerweile auch noch herausgefunden, daß diese Platte für durchaus stattliche Beträge gehandelt wird, so daß ich mich wohl über ein schönes Schnäppchen freuen darf. ![]()
Inspiriert durch meinen (mittlerweile vor-)letzten Konzertbesuch und, damit zusammenhängend, das Studium dieses Threads habe ich beschlossen, mir mal wieder ein paar der sich in meinem Plattenschrank befindenden Aufnahmen von Beethovens Violinkonzert anzuhören. Und natürlich will ich nicht versäumen, im Folgenden einige Eindrücke mit Euch zu teilen.
Erstaunt stellte ich fest, daß meine derzeitige Lieblingsaufnahme offenbar hier noch keinerlei Erwähnung gefunden hat - und das, obwohl die großen Namen der Interpreten der Qualität der Einspielung in nichts nachstehen!
Violine: Henryk Szeryng
Dirigent: Bernard Haitink
Orchester: Concertgebouworkest Amsterdam
Aufnahme: Concertgebouw Amsterdam, April 1973 (Studio)
26:02 - 9:33 - 10:14
Kadenzen: Joseph Joachim
Das herausragende Alleinstellungsmerkmal dieser Aufnahme ist (natürlich) das wundervolle Spiel des musikalischen Grandseigneurs Henryk Szeryng in seiner ziemlich idealen Verbindung aus dem großen, kräftigen Strich und der liebevollen Artikulation intimer Details. Szeryngs Geigenton ist angenehmerweise recht 'körperlich', sein Vortrag gleichzeitig aber in hohem Maße lyrisch und stets durchdrungen von einer ihm höchst eigenen, geradezu anrührenden Grundmelancholie.
Formbewusstsein und klassische Phrasierung kennzeichnen allgemein Szeryngs Spiel, höchstens ein dezentes Rubato hin und wieder gestattet er sich. Dennoch, oder gerade deswegen, wirkt alles tief empfunden und nicht etwa wie das Produkt irgendwelcher romantischer Manierismen oder sonstigen Theoretisierens - nachzuhören etwa im 2. Satz oder auch in der die Durchführung des Kopfsatzes beschließenden Kantilene. Gerade letztere (meine persönliche Lieblingsstelle des Konzerts) spielt Szeryng so berührend wie kein anderer mir bekannter Geiger.
Den passenden musikalischen Teppich für Szeryngs Kunst legen Bernard Haitink und sein Concertgebouw-Orchester - in klassisch ebenmäßiger Manier, aber nie spannungsarm, sich zugunsten des Solisten in vornehmer Zurückhaltung übend. Der Streicherklang ist erfreulich wohlkonturiert, die Aufnahme selbst hinsichtlich ihrer Durchhörbarkeit wohl aber nicht mehr der Weisheit allerletzter Schluss. Etwas hallig ist sie zudem, aber das weiß das Hörvergnügen eigentlich nicht zu schmälern.
Daß ich nur mühsam verhindern konnte, einen Superlativ an den nächsten zu reihen, lässt mein Fazit evtl. vorausahnen: dies Einspielung halte ich für essentiell. Wer sich selbst ein Bild verschaffen möchte, findet die hier besprochene Aufnahme bei Youtube:
Ich wünsche viel Vergnügen! ![]()
Dieser Einkauf datiert noch von Ende September letzten Jahres, kam mir aber gerade wieder in den Sinn, als Alfred gerade die Thread-Neuauflage für das 1. Quartal 2016 startete:
Herbert von Karajan
Sämtliche orchestralen Aufnahmen der 1980er-Jahre bei der Deutschen Grammophon (78 CDs)

Ich denke, auch wenn das Karajan'sche Spätwerk gern sehr geteilte Reaktionen hervorruft, kann ich diese Werkschau guten Gewissens in diesem Thread unterbringen - insbesondere den Kaufpreis von 9,99 EUR (gebraucht, aber so gut wie neu) berücksichtigend. Ich habe mich jedenfalls gefreut. ![]()
Ich will mich an dieser Stelle einmal auf die dicksten Brocken unter meinen Neuzugängen der letzten Monate beschränken:















Wenig Zeug ist das nicht, aber ich war ja auch lang nicht mehr hier. Kurz gesagt handelt es sich in praktisch allen Fällen um eine Mischung aus Dingen, die mich interessieren, und Angeboten, die ich nicht ablehnen konnte. Von dem Gehörten fand bislang auch alles durchaus mein Gefallen. Mit Ausnahme vielleicht der Bach-Chorwerke: dazu fand ich im ersten Anlauf keinen Zugang, mit dem so rechte Begeisterung einhergehen wollte. Alles gehört habe ich aber noch längst nicht: so kenne ich z. B. von der Strauss-Box bislang nichts, von der Wagner-Box 'nur' den Böhm-Ring, den Boulez-Ring wiederum nicht, und auch das Boulez-Werk harrt genauso noch seiner Entdeckung wie die meisten Schostakowitsch-Sinfonien und vieles aus der Beethoven-Box von EMI, die erfreulicherweise einen ganzen Haufen Aufnahmen enthielt, die ich eh schon auf meinem Einkaufszettel hatte, allen voran die Sonaten-Einspielungen von Eric Heidsieck. Ich hoffe, in Zukunft von der einen oder anderen Hörerfahrung berichten zu können...
Ein schöner Bericht, der mich in Schwierigkeiten bringt: Mit einem ähnlichen Programm werden Kopatchinskaja/Currentzis am 18.01. in Hamburg zu erleben sein. Neben dem Beethoven-Violinkonzert dann Mozarts "Prager" KV504. Allerdings ist mein Konzertplan schon so voll (am 17.01. Blomstedt/NDR-Sinfonieorchester), dass ich mir den Samstag im Hinblick auf meine Familie nicht werde "leisten" können
Vielleicht kannst Du ja Deine Familie zu einem gemeinsamen Konzertbesuch verführen... Der Begeisterung nach, die gestern nach dem Konzert allenthalben herrschte, dürften sie es kaum bereuen, Dich dorthin zu begleiten! ![]()
Auch mich hat die Nachricht von Pierre Boulez' Tod traurig gemacht - und daß, obwohl ich erst vor sehr kurzer Zeit begonnen hatte, überhaupt erste Teile seines Kompositionswerkes kennen- und liebenzulernen.
Passiert ist das anläßlich des Antrittskonzertes von François-Xavier Roth als neuer Chefdirigent des Gürzenich-Orchesters zu Beginn dieser Saison in Köln. Gespielt wurde dort u. a. die Orchesterfassung seiner Notations. Und wenn das Orchester stellenweise auch noch Luft nach oben hatte (ich bin sicher, FXR wird da einiges bewirken), so war es doch eine fesselnde und begeisternde Erfahrung für mich. Wer das selbst einmal nachhören möchte, kann dies via Youtube tun:
https://www.youtube.com/watch?v=NiXPwwEJDPY
Jedenfalls konnte ich in seiner Musik nichts von dem kühlen, im Übermaß vergeistigten Sachwaltertum entdecken, von dem ich im Vorfeld immer meinte, gelesen zu haben - ganz im Gegenteil meinte ich, viel Spannung, Tiefe und durchaus auch Wärme zu spüren. Ich war immerhin so angetan von dem dort Gehörten, daß ich mir kurze Zeit später die DG-Box mit dem kompositorischen Gesamtwerk von Boulez gekauft habe. Ich werde nicht versäumen, mich mit selbiger bei Gelegenheit näher zu beschäftigen.
Von seiner Dirigententätigkeit kenne ich bislang nur seine 8. Bruckner mit den Wiener Philharmonikern, die mir seinerzeit meiner Erinnerung nach zur akademisch daherkam. Aber Geschmäcker ändern sich auch zuweilen: ich werde die Aufnahme beizeiten noch einmal zur Hand nehmen. Desweiteren steht die DVD-Box mit der Aufnahme seines Bayreuther Jahrhundert-Rings mittlerweile bei mir im Plattenschrank, harrt aber bislang noch ihrer Entdeckung und, so hoffe ich, Bewunderung.
Heute um 16:05 auf Arte: PIERRE BOULEZ - AUF DER SUCHE NACH DER ZUKUNFT
Edit: danke für den Tipp, Bertarido! ![]() Ich denke, das werde ich mir gleich einmal zu Gemüte führen...
Ich denke, das werde ich mir gleich einmal zu Gemüte führen...
Nach längerer Zeit möchte ich auch mal wieder ein Lebenszeichen von mir geben und damit beginnen, vom gestrigen Konzert in der Kölner Philharmonie zu berichten. Das Programm des Abends las sich wie folgt:
Mozart - Sinfonie in g-moll, KV 183
Beethoven - Violinkonzert in D-dur, op. 61
Beethoven - Sinfonie Nr. 5 in c-moll, op. 67
Violine: Patricia Kopatchinskaja
Dirigent: Teodor Currentzis
Orchester: MusicAeterna
Das Konzept des Abends war offenbar im weiteren Sinne Revolution: Beethovens in Töne gesetzte Kampfschrift op. 67, flankiert von seinem (das habe ich mir im Programmheft angelesen) von französischer Revolutionsmusik inspiriertem Violinkonzert und eingeleitet von der für Mozart-Verhältnisse ungewöhnlich und neuartig düsteren 'kleinen' g-moll-Sinfonie.
Sehr dazu passend war die Darbietung sicherlich eine ungewöhnliche und recht weit ab von dem, was ein rein wienerklassisches Programm normalerweise so erwarten ließe. Ich darf vorwegnehmen: ich habe mein Kommen ganz und gar nicht bereut.
Schnell wurde klar, daß sich Teodor Currentzis und das 2004 von ihm gegründete Ensemble sich Werten wie Schönklang, klassischer Eleganz oder Formgebung nur wenig verpflichtet fühlen. So war nicht nur der Orchesterklang sehr 'original' rauh, auch in Form und Phrasierung gab sich der Dirigent viel mehr der Magie des Momentes verpflichtet als dem oft beschworenen großen Bogen, mehr dem Kontrast und dem Akzent als dem Ebenmaß. Erkennbar war der Vortrag darauf angelegt, Begeisterung für die gespielten Stücke zu wecken: von hohem Tempo, rückhaltlos und engagiert, zuweilen zulasten auch der spielerischen Perfektion. Insbesondere die eine oder andere chaotisch klingende Stelle in den Pauken ist mir erinnerlich, was den mitreißenden Gesamteindruck aber nur wenig zu schmälern wusste.
Im Violinkonzert zeigte sich Patricia Kopatchinskaja als kongeniale Partnerin mit offenbar ganz ähnlichen Vorstellungen von einem optimalen Beethoven-Vortrag wie Currentzis: viel Schwung und Emphase zeichneten ihr Spiel aus, auch ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen, wobei ihr allerdings jedes Pathos abging. Das raubte mancher Stelle für meinen Geschmack ein wenig die Tiefe, so z. B. der Kantilene zum Ende der Durchführung des Kopfsatzes, erwies sich jedoch dem Gesamteindruck als sehr zuträglich. Selbiges gilt auch für die Kopatchinskaja völlig abgehenden solistischen Starallüren: erkennbar begreift sie sich als Teil eines klingenden Teams und interagiert in erkennbar großer Nähe und Herzlichkeit mit Currentzis und seinem Konzertmeister. Dementsprechend legt sie auch den eigenen Solopart nicht als virtuoses Kabinettstückchen an sondern gleichsam als Improvisationsstimme des Orchesters, sich dabei nicht scheuend, teilweise auch an die Grenzen des noch Hörbaren zu gehen.
Bereits sehr früh zeigte sich, daß Currentzis und Kopatchinskaja den Nerv des Publikums an diesem Abend mit ihrer Herangehensweise offenbar voll getroffen hatten. So klang schon nach dem ersten Mozart-Satz das erste begeisterte Klatschen aus dem so gut wie ausverkauften Zuschauerraum. Und nach den beiden Beethoven-Stücken kannte das Publikum dann endgültig kein Halten mehr. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, überhaupt schonmal rhythmisches Klatschen des versammelten Saales in einem klassischen Konzert vernommen zu haben.
Auch rein optisch gab es übrigens einiges bemerkenswertes zu entdecken. So spielten alle Musiker, deren Instrument das erlaubt, im Stehen und nutzten die zusätzliche Bewegungsfreiheit auch erkennbar aus. Currentzis selbst verzichtete zugunsten eines direkteren Kontakts zu seinem Orchester darauf, das bereitstehende Dirigentenpult zu nutzen, sondern hielt sich die komplette Spieldauer davor auf, was für seinen nach meinem Dafürhalten reichlich eigenwilligen Dirigierstil wohl auch unabdingbar ist. Dieser basiert auf hohem körperlichen Einsatz in einem recht großen Aktionsradius: vielfach tanzte der Maestro seinen Musikern die gewünschte Interpretation des Stückes regelrecht vor; klassisches Taktschlagen blieb dafür über weite Strecken ganz außen vor, soweit ich das zu erkennen vermochte: interessant anzusehen, aber vermutlich eher nichts für Puristen.
Einen kleinen Wermutstropfen brachte der Currentzis'sche Dirigiertanz insofern mit sich, als der Verzicht auf das (mit Filz beschichtete) Pult zugunsten der (hölzernen) Bühne vielfach das Geräusch seiner Schuhe deutlich hörbar werden ließ: für mich eine eher unwillkommene Ergänzung der Tätigkeit des Paukers. Erfreut nahm ich immerhin zur Kenntnis, daß Currentzis sich gestern Abend durchgerungen hatte, eine ordentliche Hose zu tragen, nachdem er bei meiner ersten Begegnung mit ihm (vor geschätzt 2 Jahren in Freiburg) noch in einer Art schwarzer Schlafanzung-Strumpfhose aufgelaufen war. Aber das nur am Rande… ![]()
Muss man das mögen? Keinesfalls. Gehört haben darf man das für meinen Geschmack auf jeden Fall einmal! Ich für meinen Teil jedenfalls kann festhalten, wohl noch nie so von einem Konzert so begeistert gewesen zu sein, das so wenig meinen geschmacklichen Vorlieben entsprochen hat.
Im Mai werden Kopatchinskaja und Currentzis übrigens wieder zusammen zu hören sein: dann mit dem un-historischen SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg und Schostakowitsch und Berg im Programm. Ich denke, ich werde hingehen!
36 CDs. Ab 24. Januar 2014.
Das wird schätzungsweise der Re-Release dieses Schätzkens hier sein:
Also mutmaßlich wiederum ohne seine Schostakowitsch-Aufnahmen, die seinerzeit ohnehin schon bei Decca erschienen - und heute ist ja eh alles Universal. Verstehen muss man das wohl nicht unbedingt...
Lieber Willi,
besten Dank für den schönen Bericht einschließlich der Ausführungen! Ein neuer Name, der mir bislang noch gar nichts sagt - um so erfreulicher, daß Du auf ihn aufmerksam machst!
Dem schließe ich mich so gern an! ![]() Freut mich, daß Dir Levit so gefallen hat! Ich hatte selbst bereits zweimal das Vergnügen, ihn live zu erleben (einmal davon sogar in der Kölner Philharmonie), und wenn ich meiner Erinnerung nach manche Details seiner Interpretationen nicht 100%ig nachvollziehen konnte, so machte seine allein große Musikalität seinen Vortrag doch immer zum ausgesprochenen Vergnügen.
Freut mich, daß Dir Levit so gefallen hat! Ich hatte selbst bereits zweimal das Vergnügen, ihn live zu erleben (einmal davon sogar in der Kölner Philharmonie), und wenn ich meiner Erinnerung nach manche Details seiner Interpretationen nicht 100%ig nachvollziehen konnte, so machte seine allein große Musikalität seinen Vortrag doch immer zum ausgesprochenen Vergnügen.
Ähnliches gilt übrigens für seine kürzlich erschienene Debüt-CD mit Beethovens späten Klaviersonaten, die Du oben ja schon verlinkt hattest. Ich habe mich ihr ehrlich gesagt noch nicht mit der angemessenen Konzentration widmen können, darf aber nach den ersten Höreindrücken schon behaupten, daß sich diese Anschaffung unbedingt lohnt, denke ich.
Hier war Igor Levit übrigens auch schon kurz Thema: Die Jungen Pianisten.
Über kurz oder lang sollte ihm allerdings ein eigener Thread zuteil werden, schätze ich. ![]()
Zwei nicht mehr so ganz frische Neuheiten, die ich vergessen hatte zu erwähnen, sind die folgenden:
[timg]http://ecx.images-amazon.com/i…RYL._SX450_.jpg;n;300;300[/timg] .....
.....
Deren erstere geht meiner Erinnerung nach auf eine Lobrede auf Herrn Maazel zurück, die ich hier im Forum gelesen und die mich neugierig gemacht hatte.
Und die Geschichte von Gilbert Kaplan, den allein die Begeisterung für Mahlers 2. Sinfonie zu einem Musik- und Dirigierstudium trieb, fand ich schon lange spannend. Dementsprechend wollte ich mir einmal anhören, was da - um mit Helmut Kohl zu sprechen - hinten raus gekommen ist...
Mir persönlich ist Arrau vielleicht auch etwas zu schwerfällig, lieber Tobias. Aber es steht nun mal "Grave" über der Einleitung. Arrau nimmt das wörtlich: das Pathetische als Ausdruck gravitätischer Schwere.
Da hast Du natürlich recht, lieber Holger! ![]() Allerdings schien mir eine unterschwellige Hüftsteife Merkmal von Arraus ganzer Sonate und eben nicht nur der Einleitung.
Allerdings schien mir eine unterschwellige Hüftsteife Merkmal von Arraus ganzer Sonate und eben nicht nur der Einleitung.
Wobei ich nochmal betonen möchte: das ist nur sehr bedingt geeignet, Arraus Leistung zu schmälern. Aber wenn man immer nur die größten der Großen miteinander vergleicht, bekommen halt auch solche vermeintlichen Kleinigkeiten Bedeutung.
Würde der Pianist mit der "gebotenen Leidenschaft" nicht eher in der "Appassionata" aufgehen wollen (sollen), und wäre in der Pathétique nicht eher Erhabenheit, Feierlichkeit, Getragenheit u. a. angebracht?
Wie dem auch sei, es ist natürlich völlig legitim, dass wir bei solchen Punkten nicht immer einer Meinung sein können. Sonst kämen ja auch fruchtbare Diskussionen überhaupt nicht zustande.
So sieht's aus, lieber Willi - geradezu langweilig wäre das. ![]()
Zur Sonate und ihrer Interpretation: ich weiß / denke, Du siehst die Pathétique als vorwiegend lyrisches Stück. Dies entspricht in der Tat überhaupt nicht meiner Auffassung. Natürlich hat sie liedhafte und melodiöse Stellen. Die aber sehe ich eher als Gegenpol (mithin spannungserzeugendes Element) zu Donner, Sturm und Drang. Charakterprägend für die Pathétique sind für meine Begriffe klar Dinge wie drängende Unruhe, Steigerung und Klimax, dynamische Kontraste und dergleichen. Für das Finale und insbesondere das Adagio gilt das natürlich nicht im demselben Maße wie für den Kopfsatz, aber auch dort verleihen zum Teil fast ans Brutale grenzende Härten dem Stück ihr Gepräge.
Und daß op. 13 meiner Meinung nach so zu sehen ist, schließt ja auch nicht aus, daß womöglich ganz ähnliches für die Appassionata gilt. ![]()
Warum nicht auch mal die Pathétique-Sonate von Beethoven hören?

Weiter zum nächsten Schwergewicht in Sachen Beethoven: Claudio Arrau - hier seine Einspielung der Pathétique aus den 1960er-Jahren.

9:06 - 6:19 - 4:36
Ich will gleich mit der Tür ins Haus fallen: auch Arrau vermag es für meinen Geschmack nicht, das Wesen dieser Sonate vollständig zu vermitteln. Niemanden wird überraschen, daß Claudio Arrau kein Mann des Überschwangs ist, sondern großer Ernst und Sorgfalt sein Beethoven-Spiel prägen. Dies ist natürlich zuvorderst als bedeutendes Qualitätsmerkmal zu sehen, dem pathetischen Charakter des Stücks steht das Naturell des Pianisten hier allerdings eher entgegen. So scheint Arrau fast der Respekt vor dem Werk daran zu hindern, mit der gebotenen Leidenschaft in selbigem aufzugehen: oft scheint sein Zugriff eine Nuance zu statisch - zuviel wird hier zelebriert statt er- und belebt.
Allerdings tut auch hier ein relativierendes Wort not: das Gesagte ist einmal mehr Jammern auf höchstem Niveau, wenn nicht eine reine Geschmacksfrage. Zum einen ist Arraus Ansatz zwar relativ zurückgenommen, aber kein wirklich problematischer. Zum anderen ist sein Spiel pianistisch natürlich vom feinsten - technisch wie intellektuell. Eine Vielzahl großer und kleiner Details zeugen davon. Als Beispiele seien hier nur die spannend gestaltete und per Rubato um einen schwankenden Aspekt erweiterte Grave-Einleitung oder der tief empfundene, in größter Ruhe dargebotene Mittelsatz genannt. Daneben ist auch hier allein schon Arraus typischer dunkel-warmer Klavierton ungemein hörenswert.
Fazit: kein Optimum im Ausdruck, aber eine voll gültige Interpretation, die man gehört haben darf.
Grundsätzlich stimme ich Alfred in dieser Einschätzung zu. Bei einer CD, die nur 5 Euro kostet, kann man nicht unbedingt ein textreiches (sprich: viele Seiten umfassendes) und drucktechnisch aufwendig bebildertes Booklet erwarten.
Was man allerdings sehr wohl erwarten kann, sind vollständige Werkangaben mit Tonart und Opuszahl und darüber hinaus auch Angaben zum Datum der Aufnahme und auch zum Ort, an dem diese entstand. Diese Dinge sind einfach zu realisieren und kosten keinen Cent mehr. Wenn man diese "Beiblättchen" (Booklets kann man die ja eigentlich nicht mehr nennen) schon bedruckt, dann kann man diese paar editorisch wichtigen Angaben noch mit dazustellen. Leider finden diese Grundregeln nicht überall Beachtung. Und ich wage zu behaupten, dass dies nicht an dem Gedanken, Kosten sparen zu wollen, liegt, sondern schlicht und einfach von den schlampig und oberflächlich agierenden Gemütern bei manchen Labels nicht einmal angedacht wird. Denn diese Leutchen können sich gar nicht vorstellen, dass sich jemand für solche Informationen interessieren könnte. Sich in potentielle Kunden und Käufer hineinzudenken, ist denen nicht gegeben.
Ganz meine Meinung!
Wobei das Knausern mit Informationen über die Einspielung ggf. auch noch einen anderen für die Plattenlabels angenehmen Nebeneffekt haben kann: in Verbindung mit einer neuen Verpackung ist das verschiedentlich schon geeignet, dem willigen Konsumenten eine Neu-Aufnahme vorzugaukeln, wo keine ist. So zumindest mein Eindruck. Wobei ich natürlich nie jemandem etwas Böses unterstellen würde... ![]()
Nach der Lektüre von Willis Pathétique-Rezension über Aldo Ciccolinis Einspielung bin ich vorhin über diese Box gestolpert:

44 Taler für 56 CDs scheint mir jedenfalls reichlich günstig zu sein.
Sodele, frisch & kalt aus der Packstation.
Das trifft bei mir auch zu. Da ist sie also meine allererste Opern-DVD:

Außerdem noch Beethoven von Gulda:

Den Weg zur Arbeit versüsste mir heute Claudio Arrau mit seiner Pathétique:

Und weiter im Text! Als nächstes zu einem meiner erklärten Lieblinge: Maurizio Pollini.
Angenehmerweise ohne große interpretatorische Auffälligkeiten geht Pollini die Einleitung an, wobei er die 'Grave'-Vorschrift trotz des verhältnismäßig flotten Tempos erkennbar ernstnimmt und sich nicht scheut, ihr mit Lautstärke und Härte Gestalt zu verleihen. Ein Zug, der auch für seinen weiteren Vortrag bedeutsam sein wird.
Pollinis Allegro stellt sich dann ebenfalls mitnichten über-interpretiert dar: kein falscher temporaler Überschwang, kein übertriebenes Rubato. Stattdessen setzt er die Wirkungstreffer (passender)weise über seine dynamische und strukturelle Anlage, die den Werk-Charakter zu jeder Zeit perfekt unterstreicht: da dröhnen die Bässe gewaltig, wo nötig, an anderen Stellen ist Zwei- und Dreistimmiges mit großem Überblick und Liebe zum Detail verwirklicht - jeder Ton scheint begeisternd liebevoll ausgearbeitet. Als nur ein kleines Beispiel sei hier das in Takt 89 (resp. 101) angelegte und sich dann ab Takt 94 (105) manifestierende Doppel-Crescendo genannt: wie Pollini hier nicht nur die Spanne von piano <---> forte mit großer Weite interpretiert, wie er seinen Anschlag von einem weichen Rund zum harten Staccato entwickelt und (wichtig, wie ich finde!) jedes accelerando vermeidet (von sonstiger Effekthascherei ganz zu schweigen): das ist höchste Klavierkunst und trifft Beethovens Intentionen meiner bescheidenen Meinung nach auf das genaueste.
Kann man das Adagio der Pathétique überhaupt falsch spielen? Pollini kann es natürlich nicht: höchstens das Tempo gerät ihm womöglich eine winzige Spur zu flott. Allerdings erschließt sich diese Herangehensweise mit den tänzerischen Bässen im 3. Teil, die auch dem langsamen Satz ein vorwärtstreibendes Moment verleihen, wiederum als sinnvoll und durchdacht. Einmal mehr zahlt sich hier Pollinis sorgsam gestaltete Balance zwischen strukturellen und melodischen Aspekten aus. Nur die Steigerung im C-Teil gestaltet er wieder mit aller verfügbaren Kraft - was für ein Unterschied zu Brendel (um den hier noch einmal heranzuziehen)!
Das bisher gesagt lässt sich prinzipiell in vollem Umfang dann auch auf den Schlusssatz übertragen: auch das ist spielerisch und interpretatorisch alles vom denkbar feinsten.
Bei dieser Einspielung (entstanden anno 2002) handelt es sich um ein typisches Spätwerk Pollinis mit leichten Verschiebungen hin vom viel zitierten 'klassischen Ebenmaß' hin zu romantischem Überschwang - mehr Fülle und Wärme eingeschlossen. Hier gibt sich der Meister trotz seines fortgeschrittenen Alters Beethovens Theatralik jedenfalls mit vollem Einsatz hin: da hört man Pollini nicht nur manchmal (nicht sonderlich störend) mitsummen, auch das Dröhnen des Flügel-Holzes wird stellenweise fast spürbar. Herausragendes Alleinstellungsmerkmal des späten Pollini allerdings ist sein ungeheuer farben- und facettenreicher Klavierton, dem geradezu etwas magisches anhaftet - das kann so sonst niemand. Ich bin überzeugt, vor 20-30 Jahren hätte sich Pollinis Aufnahme merkbar anders angehört: schlanker, strukturorientierter, brillianter - aber auch ein Stück kälter.
Mein Fazit wird angesichts des Gesagten kaum überraschen: unter den mir bekannten Einspielungen von Beethovens op. 13 ist diese hier mein klarer Favorit. Sollte ich nur eine Pathétique für die sprichwörtliche einsame Insel empfehlen: es wäre diese hier.
Ich glaube, lieber Felix, dass dem nicht so ist. In seinem Buch "Über Musik" sagt Brendel u. a.:
Wenn ich Felix da einmal zur Seite springen darf, lieber Willi, glaube ich aber schon, daß dem so ist. ![]()
Das von Brendel gesagte und von Dir zitierte schließt zwar aus, daß Musik ohne Interpretation sprechen kann. Auch bzw. gerade vor dem Hintergrund von Brendels Ausführungen besteht allerdings die Möglichkeit, daß das "persönliche Verständnis" und die "privaten Gefühle" des Interpreten geeignet sind, bestimmte Aspekte des Werkes zu vernachlässigen, wenn nicht zu eliminieren. Ich denke, nichts anderes wollte Felix oben zum Ausdruck bringen.
Das ein solcher Fall bei Brendels Pathétique vorliegt, halte ich zumindest für eine ernstzunehmende Hypothese.

Beethoven - Klaviersonate Nr. 7 (Pollini)
Rein zufällig hatte ich diese Aufnahme gerade in den Fingern...
Die Neueinspielung von Buchbinder ist auf jeden Fall viel durchdachter, vielseitiger als die alte. Die alte hat zwar durchaus Esprit aber wirkt auf mich beizeiten gar arg pauschal. Mit Guldas Einspielung kann man sie jedenfalls nicht auf eine Stufe stellen. Bei der neuen Einspielung sieht das schon ganz anders aus. Allerdings - als kleine Vorwarnung - Rubato spielt Buchbinder hier sehr viel.
Och, viel Rubato ist sicher nicht, was ich - gerade bei Beethoven - von Hause aus für unbedingt notwendig halten würde - aber ebensowenig ist es ein Totschlagargument. Und nach all der Begeisterung, die Buchbinders neuen Aufnahmen schon entgegengebracht wurde, werde ich schon aus Neugier über kurz oder lang sicher auch einmal reinhören.
"Pauschal" ist übrigens sehr schön gesagt! ![]() Ein wenig 'abgearbeitet' wirkt insbesondere im Allegro-Teil des Kopfsatzes schon einiges...
Ein wenig 'abgearbeitet' wirkt insbesondere im Allegro-Teil des Kopfsatzes schon einiges...
Und gleich weiter im Text: ich wandele weiter auf Felix' Spuren und höre nach Brendel Buchbinder - auch hier in einer älteren Einspielung (seiner ersten, wenn ich richtig informiert bin):
Buchbinders Grave-Einleitung hat seinerzeit überhaupt erst mein Interesse an diesem Pianisten geweckt, weil ich sie so beeindruckend fand: schwer und langsam aber nicht schleppend ist sie; dabei sorgsam ausformuliert, mit kraftvoller Betonung der Forte-Akkorde, die den fahlen und melodiösen Elemente ihren Platz als Episode zuweisen. Mit dem Einstieg ins Allegro legt Buchbinder dann durch Betonung der Bässe viel Wert auf die drängenden Aspekte, legt Steigerungen groß an und scheut sich nicht, die dynamische Spannweite im Namen des Pathos insbesondere nach oben hin voll auszunutzen. Allerdings beschädigt er die erzielte Wirkung für meinen Geschmack zum Teil wieder durch etwas zuviel hektisch wirkenden 'Zug' in seinem Spiel. Auch scheint sein Augenmerk nicht allzu sehr auf den klanglichen Schönheiten des Kopfsatzes zu liegen. Ein bißchen mehr Pedal, ein wenig mehr legato hätte ich da durchaus gut gefunden - wie auch Buchbinders Klavierton (zumindest hier) ohnehin nicht der brillianteste ist, den die Welt je gesehen hat.
Dann das Adagio: hier findet Buchbinder dann - ganz dem Charakter des Satzes entsprechend - die nötige Ruhe. In getragenem Tempo, mit minimalem Rubato und in großer Schlichtheit stellt Buchbinder hier die Beethoven'schen Schönheiten heraus. Lediglich der schuberthafte C-Teil wartet mit einem kleinen 'Ausbruch' auf, der bei Brendel so nicht stattfand bzw. eingeebneter wirkte - da werde ich wohl doch nochmal in die Noten schauen müssen, wenn ich wieder zu Hause bin…
Im Finale versteht es Buchbinder dann sehr schön, mittels ausgeglichener Betonung beider Hände den beschwingten Charakter des Stücks zu unterstreichen. Wobei er auch hier nicht versäumt, die eine oder andere Ecke und Kante mit Verve zu ihrem Recht zu verhelfen. Final-Kehraus hin oder her: auch hier ist "Pathétique" noch Programm und wird auch so transportiert.
Unter dem Strich halte ich Buchbinders Aufnahme mit leichten Abstrichen für eine sehr empfehlenswerte. Und wenn ich mir die Lobeshymnen über seine Neu-Einspielung ansehe, in denen es - von Tamino bis hin zum Pianisten selbst - unisono heißt, sie übertreffe die hier vorliegende alte bei weitem, dann bin ich jetzt schon auf den Tag gespannt, wo ich die in den Fingern halten werde!
Ich jedenfalls habe dasselbe "Problem" wie Du, und falls Du Dir das alles einbildest, bist Du damit nicht alleine. Inzwischen habe ich mir auch die 1. und 2. Einspielung genau angehört (ja, meine letzte Besprechung bezog sich auf die 1994er Einspielung) und würde der von Dir besprochenen Interpretation aus 1972 fast den Vorzug vor den anderen geben. Denn gerade das Grave kommt hier noch am ehesten zu seinem Recht (und Brendel braucht mit 2:13 min auch diesmal deutlich länger). Was alle drei Einspielungen gemeinsam haben (wobei die erste die noch "normalste" ist), ist das Einebnen von (dynamischen) Kontrasten, die Beschränkung auf die Struktur - also das, was Du "analytische" Interpretation nennst. Mit dem Ausdruck habe ich so meine Probleme, denn er suggeriert intellektuelle Überlegenheit. Tatsächlich habe ich eher den Eindruck, dass Brendel die "dämonische" Seite an Beethoven schlicht und einfach nicht akzeptiert bzw. nicht wahrhaben will. Die Musik soll sozusagen wie bei Mozart und Haydn aus sich selbst heraus sprechen. Das finde ich bei Beethoven zu einseitg. Man sollte auch nicht vergessen, dass Beethoven ein Mittzwanziger war als er das Werk schrieb, wodurch eine zu altersmilde Herangehensweise ohnehin verfehlt scheint. Der langsame, nicht dramatische Satz gelingt Brendel in allen drei Aufnahmen sehr gut, auch wen mir zumindest Buchbinder (2. Einspielung) deutlich besser gefällt.
Du hast natürlich ganz recht, daß 'analytisch' nicht der beste aller Begriffe für das von mir gemeinte ist. Wobei ich schon zum Ausdruck bringen wollte, daß Brendels Zugriff auf Beethoven mehr erdacht als erfühlt wirkt - ohne dabei eine Überlegenheit implizieren zu wollen. Vermutlich meinte ich 'vergeistigt', oder dergleichen. ![]()
Wir sind uns auch einig, daß das nicht reicht, um Beethoven in Gänze darzustellen - sicherlich nicht nur die älteren Werke betreffend. Und wie ich mich eben erinnerte (bzw. zur Sicherheit nochmal nachlas ;)) hatte ich schon einen ganz ähnlichen Eindruck von Brendels Umsetzung von Beethovens 1. Klavierkonzert. In Verbindung mit Deinen Ausführungen zu den anderen Sonaten-Einspielungen Brendels lässt mich das also vermuten, daß er für Beethoven womöglich grundsätzlich nicht die Ideal-Lösung parat hat. Ich werde sehen, ob ich dazu Gegenbeispiele finden kann!
Und wenn ich schon dabei bin, kann ich ja auch gleich meine Liste hier verewigen:
8 - 3 - 9 - 1 - 0 - 7 - 4 - 6 - 5 - 2
Insbesondere die Ränge (Ranks...?) 1-3 sind dabei allerdings fortwährenden Schwankungen unterworfen.


