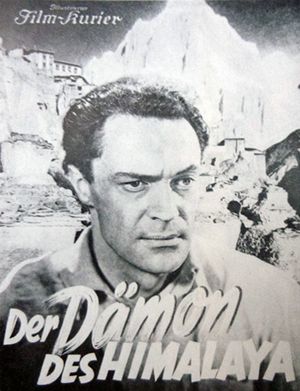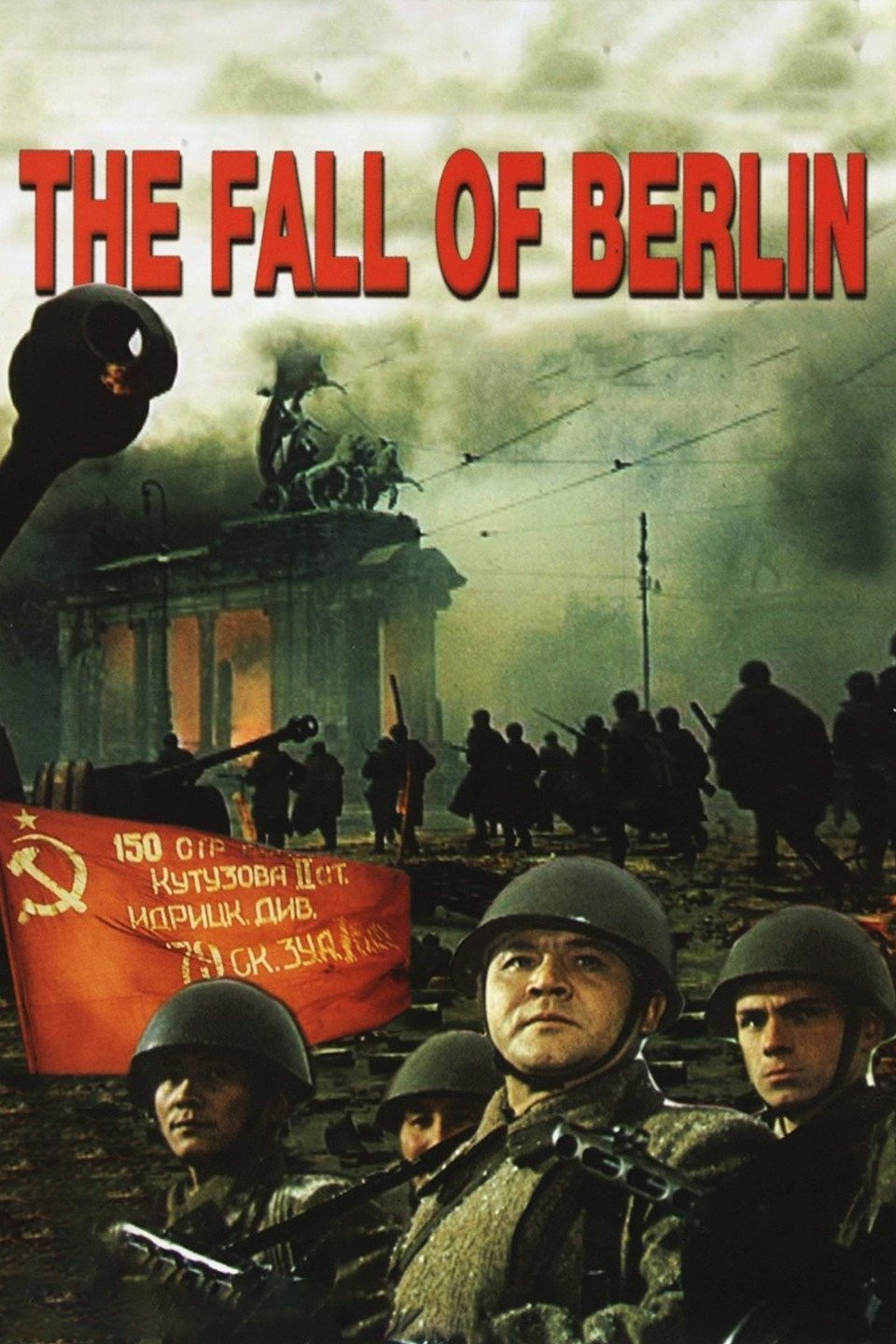Heute, am 10. Juli, feiert unser geschätztes Tamino-Mitglied Adriano seinen 80. Geburtstag. Es ist eine besondere Ehre für uns glaube ich sagen zu dürfen, einen solchen Künstler in unserem Kreis haben zu dürfen. Seinen „runden“ Geburtstag, der auch in unserer Zeit technisch-medizinischer Zeit Errungenschaften ein gesegnetes Alter bedeutet, nehme ich zum Anlass, mit ihm eine Folge von Gesprächen über ihn und seine Kunst hier auf meiner Kolumnenseite zu veröffentlichen, die heute mit einem Eröffnungsgespräch beginnen wird. Es ist eine große Freude für mich, dass Adriano diesem meinem Vorhaben zugestimmt hat und ich freue mich über lehrreiche und spannende Beiträge von ihm mit all seinen reichen Erfahrungen seines Künstlerlebens, seinen so vielfältigen künstlerischen Aktivitäten, seinen Begegnungen mit anderen Künstlern und seinen Einblicken in die Musikkultur von heute.
Gespräch mit Adriano zu seinem 80. Geburtstag am 10.7.2024
Lieber Adriano,
erst einmal gratuliere ich Dir ganz herzlich zu Deinem Geburtstag und wünsche Dir vor allem Gesundheit und dass Dir Deine Schaffenskraft und Freude an der Kunst erhalten bleibt!
Ein solcher Tag sollte ein schöner und denkwürdiger Tag sein und so ist meine erste Frage: Wenn Du Dir selbst einen Geburtstagsstrauß überreichen würdest, wo die Blumen die Erinnerung an Deine schönsten Ereignisse und Erlebnisse Deiner Künstlerlaufbahn sind, welche würdest Du nennen?
A.: Danke sehr, Holger, für die Gratulation! Man befindet sich bereits in dem Alter, wo die Gedanken an den eigenen Gesundheitszustand an erster Stelle kommt; man setzt sich täglich damit auseinander. Ich habe das große Glück, noch gut „beisammen“ zu sein, doch ich verliere immer mehr liebe Freunde – zum größten Teil noch jüngere als ich – was mich sehr schmerzt. Da kommt die Diagnose Krebs leider an erster Stelle, vor allem Prostata-, Lungen- und Bauchspeicheldrüsenkrebs. Alleine über die 2023er-Weihnachtszeit gab es für mich einige traurige Nachrichten!
1994 musste ich an einem Stimmbandkarzinom operiert werden, doch mit dem großen Glück, dass sich dort keine Metastasen bilden können. Vor etwa 8-10 Jahren traten Nebenwirkungen auf, weil man mich damals (noch unwissend) doppelt intensiv bestrahlt hatte. Nun klingt meine Stimme immer etwas belegt und meine Pläne, mich nach der Pensionierung wieder als Schauspieler, Sprecher und Rezitant beschäftigen zu dürfen, fielen ins Wasser.
Was meine Künstlerlaufbahn betrifft, da hat sich bereits vor Corona vieles verändert – so dass ich mich leider bereits als „gesunkener Stern“ betrachten muss. Für meine noch vielen CD-Projekte gibt es keine Sponsoren mehr und als Komponist und Arrangeur produziere ich noch mehr für die Schublade als früher. Darüber kann man sich schon verbittert fühlen, doch man muss realistisch bleiben: Es gibt so viele talentierte junge Dirigenten und Komponisten, dass man nur noch staunen – und immer noch daraus lernen kann. Aber oft gibt es auch nur etwas zum Kopfschütteln!
Als schönste künstlerische Ereignisse meiner „Laufbahn“ würde ich z.B. die Aufnahme (in Bratislava) der Respighi-Kantate „La Primavera“ und die Templeton-Strong-Aufnahmen in Moskau der „Sintram“-Symphonie und der Suite „Die Nacht“ betrachten. Da funktionierte auch die Studio-Atmosphäre bestens. Und dann noch, dass ich Marco Polo-Naxos überzeugen konnte, die Sylvio Lazzaris Symphonie und Ernest Fanellis „Tableaux Symphoniques“ einzuspielen (bis es soweit kam, war es alles andere als einfach!), kann ich schon als einen Triumph betrachten. Auch Bernards Herrmanns Filmmusik „Jane Eyre“ gehört zu meinen bevorzugten, gelungensten Einspielungen!
H.K.: Für meine inzwischen doch schon recht umfangreiche und sich stetig erweiternde Adriano-Sammlung habe ich eine eigene Abteilung in meinem CD-Regal reserviert. „La Primavera“ und auch den Templeton-Strong, den ich durch Dich entdeckt habe, liebe ich sehr. Bei jpc sehe ich gerade, dass sie da bei Deiner Respighi-CD eine Fono Forum-Rezension vom August 1995 zitieren. „Die Umsetzung unter der Leitung von Adriano ist so famos gelungen, daß es schier unglaublich scheint, daß dieser exzeptionelle Respighi-Kenner sein täglich Brot als Souffleur an der Züricher Oper verdient." Wenn ich das lese und auch mit Deinen famosen Aufnahmen im Kopf kann man da wirklich ernste Zweifel an unserem Musikbetrieb bekommen. Da musst Du jetzt natürlich nicht darauf antworten, die Frage, warum man Dich auch nicht als Dirigent für Konzerte engagiert hat, können wir auch später noch behandeln.
A.: Gerne später! Ich habe in der Tat über 20 Jahre lag als „maestro suggeritore“ (als dirigierender Souffleur) am Zürcher Opernhaus gearbeitet. War hier der Erste, der von Alexander Pereira diesen Titel bekam – was an der Scala eine ganz gewöhnliche Sache ist. Das war mein Brotberuf… Dirigieren an diesem Ort durfte ich nur bei Klavierproben. Dabei konnte ich viel lernen, vor allem von Maestri wie Nello Santi, Nikolaus Harnoncourt, Michel Plasson, Serge Baudo, Marcello Viotti usw.; das waren aber auch Persönlichkeiten, die ihren Beruf sehr ernst nahmen und allen Mitwirkenden Vieles mitteilen und mitgeben konnten.
H.K.: Darauf werden wir noch kommen – Deine Prägungen, Deine Lehrer, Ernest Ansermet. Aber bleiben wir bei Deinen Aufnahmen. Da darf natürlich Dein wohl gewichtigstes Projekt nicht unerwähnt bleiben: Die Aufnahme aller Symphonien von Fritz Brun.
A.: 2003 starteten dann meine intensiven Recherchen und Einspielungen der gesamten Orchesterwerke von Fritz Brun, eines Komponisten, der mir sehr ans Herzen gewachsen ist – weil ich mich auch seelenverwandt mit ihm finde. Dies alles war mit harter Arbeit verbunden, denn diese Musik ist nicht leicht. Mit der Zeit durfte ich derart viel Material über Brun auftreiben, um eine dreieinhalbstündige Video-Biographie über ihn realisieren zu können; auch daran habe ich einige Jahre lang gearbeitet. Dieser Film ist in 26 kürzeren Kapiteln gestaltet, die man separat „konsumieren“ kann; statt einer Biographie in Buchform, kriegt man nun aufs mal Bild und Ton. Ich bin da verantwortlich für Drehbuch, Schnitt und größernteils auch für die Kamera.
Sieht ganz so aus, dass diese Brun-Projekte mein Schwanengesang werden!
H.K. Dein Brun-Projekt ist wirklich eine große Lebensleistung und ein Verdienst, für das Du Dir wahrlich einen Orden verdient hättest. Nicht nur die Aufnahmen sind famos, dazu kommen noch Deine äußerst kenntnisreichen Erläuterungen zu den Werken und den ganzen Hintergründen, durch die man in die Brun-Welt eintreten kann. Das ist alles so bedeutend, dass wir uns dem natürlich noch ausführlich widmen sollten und auch widmen werden denke ich.
A: A propos „Orden“: 2009 schrieb ein Rezensent über meine Einspielung der „Tableaux“ von Fanelli, dass ich dafür den Orden der französischen Ehrenlegion verdient hätte…
Für die Fritz-Brun-Box gab es hier in der Schweiz eine moderat positive Kritik, die Fehler aufweist, also nicht gut recherchiert worden war. In einer weiteren wurde meine Interpretationen als „glanzlos“ befunden – und es musste darin noch unbedingt erwähnt werden, dass ich früher als kaufmännischer Angestellter bei Banken und Versicherungen gearbeitet hatte. Die verantwortliche Redaktion erhielt daraufhin empörte Reaktionen von zwei Musikwissenschaftlern. Einer wies auf Fehler hin und meinte, der Autor hätte sich die CD-Box nicht einmal richtig angehört. Der andere meinte, dass ein derart unvermögender Rezensent besser gefeuert werden sollte…
Na ja, es gibt halt auch Provinz-Rezensenten, die im Boulevard-Stil schreiben wollen, um interessant zu wirken… Ich habe nichts gegen faire, fundierte negative Rezensionen, doch dann muss aber alles stimmen! Es gibt leider aber auch Rezensenten, die, weil sie ein Musikstück selber nicht mögen, es dann auch nicht gut aufgeführt finden…
H.K.: Die Jugend ist die Zeit, wo man das Leben vor sich hat, das „Mittelalter“ das, wo man vor allem vielleicht in der Gegenwart schaffen will und im Alter kommt der – beseligende aber auch etwas schmerzliche – Rückblick. Ich selber habe auch schon die Altersgrenze zu dem, was ich etwas selbstironisch das „Opa-Alter“ nenne, überschritten und tröste mich immer ein bisschen mit Nietzsches Warnung: „Man soll nichts bereuen!“ Wünsche natürlich behalten wir immer und es wäre glaube ich auch schlimm, wenn wir sie nicht mehr hätten. Und eine gewisse Wehmut gehört glaube ich auch dazu. Bei all Deinen vielen künstlerischen Unternehmungen, bist Du eigentlich zufrieden mit dem, was Du erreicht hast? Gibt es noch offene Projekte, Die Du unbedingt in der Zukunft verwirklichen möchtest?
A.: Zufrieden kann ich mich schon fühlen, denn ich durfte Vieles erreichen, was ich mir nie erträumt hatte. Ich, der nicht einmal ein Konservatoriums-Diplom hatte, durfte Dirigent und Komponist werden! Da muss man fast ein schlechtes Gewissen kriegen, wenn man die aufwändigen Biographien arrivierter Dirigenten liest! Ich durfte anspruchsvolles Repertoire dirigieren, ja sogar Werke einspielen, die noch niemand aufgeführt hatte oder längst vergessen waren! Ein Vorteil für mich: Rezensenten konnten meine Interpretationen nicht einmal mit vorangehenden vergleichen.
Natürlich gäbe es noch Dutzende Wunschprojekte – die bereits damals auch bei Naxos vorlagen (ein Teil darunter wurde bereits genehmigt und dann alle zusammen in einer kurzen Aktion gestrichen…). Also „unbedingt noch verwirklichen“ darf ich nicht mehr sagen, es wäre anmaßend utopisch.
H.K.: Wenn Du Dir selber Deine Frage beantworten würdest, was Du von all Deinen künstlerischen Leistungen als Deine wichtigste nennen würdest, welche wäre das dann?
A.: Ich betätigte mich in meinen Sturm-und-Drang-Jahren 1965-75 auch als Theaterautor und als Zeichner. Und 2011 schrieb ich sogar ein Buch, das nicht im Geringsten mit Musik zu tun hat; doch zu all dem habe ich inzwischen eine grosse Distanz gewonnen. Leider aber ist ein verdammt gutes Gedächtnis noch da, sodass gewisse Erinnerungen (leider auch die unangenehmenren) ab und zu auftauchen und ich mich „ganz privat“ schämen muss. Aber bereits damals war ich selbstkritisch und betrachtete all jene verrückten Aktivitäten als „Lehrgänge“. Gewisse alte Unterlagen (die inzwischen in der Zürcher Zentralbibliothek gelandet sind) sind aber heute recht amüsant zu lesen; ich hab’s letztens selber mal probiert. Diese Dreistigkeit, mich zu präsentieren hätte ich heute natürlich nicht mehr. Ich war übrigens auch als Fotomodell für Werbung tätig…
H.K.: Das ist eine beeindruckende Vielseitigkeit, wenn ich das kommentieren darf! Eine staunenswerte Begabung, mit der Du gesegnet bist!
Blicken wir nun von Deinem Heute auf Deinen Anfang zurück: Wann hast Du realisiert, dass Deine Berufung die Kunst ist und den Entschluss gefasst, Künstler zu werden? Soviel ich weiß, war das alles nicht leicht und Du hattest einige Kämpfe zu kämpfen.
A.: Na ja, da ist vor allem meine Familie schuld, gegen die ich sehr kämpfen musste. Dieses sehr unangenehme Kapitel meiner Jugend (vor allem die Jahre 1955-1964) lasse ich lieber beiseite, außer mit der Betrachtung, dass ich, sagen wir mal ganz clichéhaft „durch Schmerzen empor“ gehen musste.
H.K.: Was waren die wichtigsten Stationen Deiner künstlerischen Laufbahn?
A.: Die Tatsache, dass ich Dirigent werden durfte (allerdings nur als CD-Dirigent, denn auf dem Podium wollte mich noch niemand haben), ist schon ein Meilenstein! Daran hatte ich am wenigsten geglaubt.
H.K.: Heute ist Dein Geburtstag und die dazu ganz konkret die Frage: Wirst Du ihn feiern – mit Deinen vielen Freunden? Es gibt ja das Sprichwort „Der Prophet gilt nichts im eigenen Land“. Wird Deine Schweizer Heimat an diesem Tag an Dich denken und Dir die Ehrung, die Du verdienst, auch geben?
A.: Die Schweiz wird zu diesem „Anlass“ bestimmt nicht an mich denken. Zurzeit muss ich sogar kämpfen, mit einer gerade ab diesem Monat gültigen, verminderten Rente auskommen zu müssen.
In meinem Land war ich in der Tat nie ein Prophet. In Rezensionen wurde ich mehrmals belächelt und nicht ernst genommen. Dafür kann ich mit Stolz behaupten international ziemlich bekannt geworden zu sein. Als man 2015 einen Auszug meiner CD von Fritz Bruns Vierter Symphonie am Schweizer Rundfunk abspielte, erwähnte der Moderator meinen Namen – was dann seine Co-Moderatorin veranlasste, verdutzt zu fragen: „Adriano?? Gibt es ihn noch?“.
Auch hierzulande muss man gewissen Kreisen angehören, um gefördert und aufgeführt zu werden. Und in solchen Kreisen wollte ich nie verkehren.
Die Schweiz ist ein sehr kleines Land und die meisten ihrer Künstler haben es sehr schwer, denn es werden nur die bereits arrivierten gefördert – vor allem damit sie uns im Ausland gut vertreten. Unsere „nationale“ Pro Helvetia-Stiftung (und nicht nur die) ist leider seit vielen Jahren eine elitäre Firma geworden, die nur noch fördert was sie gut findet. Früher wurden viel mehr Projekte gefördert (auch CD-Projekte – die nun auch nicht mehr in Frage kommen), die von unbekannteren Künstlern unterbreitet wurden. Auch private Kulturförderer sind inzwischen echt knausrig geworden, dass man es nicht verstehen kann, in einem der reichsten Länder der Welt zu leben!
H.K.: Nun zum Schluss die Frage: Wenn wir zu Deinem Ehrentag eine Deiner vielen Aufnahmen hören wollen, welche würdest Du uns empfehlen?
A.: Vielleicht gerade eine der von mir weiter oben erwähnten.
H.K.: Ich werde mir Primavera anhören – und eine von Deinen Ibert-Aufnahmen, die ich zuletzt entdeckt habe und wo Du mich so großzügig auch mit den vergriffenen Aufnahmen versorgt hast. Die Respighi-CD und den Templeton-Strong sind weiterhin bei jpc erhältlich:
https://www.musicweb-internati…ev/2003/Aug03/Fanelli.htm
H.K.: Ich bedanke mich sehr für Deine Antwort, wünsche Dir noch einen glücklichen Geburtstag und freue mich auf die baldige Fortsetzung unseres Gesprächs.
A.: Nochmals, vielen herzlichen Dank. Ich führe es mit Freude weiter. 😊
H.K. Die ist auch sehr groß auf meiner Seite!