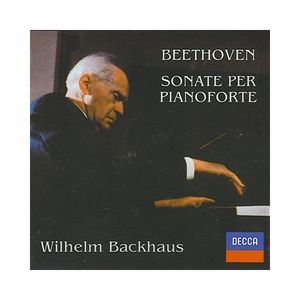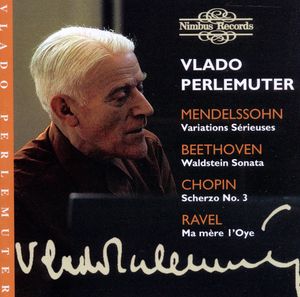„Ich wünsche, dass er (Adolph Bernhard Marx, H.K.) fortfahre, das Höhere und Wahre im Gebiete der Kunst immer mehr und mehr aufzudecken; dies dürfte das bloße Silbenzählen wohl nach und nach in Abnahme bringen.“
(aus einem Brief Ludwig van Beethovens vom Juli 1825)
I Vorbemerkung
Mir ihrer funkensprühenden Virtuosität, ihrer unheroischen Leichtigkeit, ihrer unscholastischen Eingängigkeit und nicht zuletzt ihrer Schönheit ist Ludwig van Beethovens Waldstein-Sonate op. 53 eine der beliebtesten Beethoven-Sonaten sowohl bei den Pianisten als auch beim Publikum. Doch der Schein des Fasslich-Leichten trügt. Die Wahrheit ist: Die Waldstein-Sonate gehört zu den am schwierigsten zu interpretierenden der 32 Klaviersonaten Beethovens, wie dies Joachim Kaiser in seinem bekannten Buch überzeugend dargelegt hat. Nimmt man Ernst, was Kaiser ausführt, dann ist die Interpretation der Waldsteinsonate nicht nur eine Herausforderung, sondern sogar so etwas wie eine Überforderung des Interpreten. Joachim Kaiser: „Eine vollendete Darstellung der Waldsteinsonate gibt es nicht. Vielleicht kann es sie gar nicht geben. Vielleicht läßt sich der klassische Ausgleich der Waldstein-Spannungen nur erahnen, nicht erspielen.“
Wie kommt Kaiser zu dieser für die meisten Leser doch wohl etwas überraschenden Sicht? Ich möchte dies mit zwei Beispielen erläutern: In einer letzten Sendungen des Kulturmagazins „Aspekte“ war der Pianist Igor Levit zu Gast und erläuterte kurz am Flügel einige Eigenheiten Beethovens – das, was an seinem Klavierstil so ungewöhnlich ist und ihn zugleich geradezu unwiderstehlich anziehend macht. Er kam u.a. auf die Hammerklaviersonate op. 106 zu sprechen, spielte die berühmte Trillerpassage aus der großen Fuge an und sagte dem Sinne nach: „Sehen Sie, das ist die reine Wut!“ Ein Wutausbruch in einer Fuge ist in der Tat ungewöhnlich – bei Johann Sebastian Bach wäre so etwas schlicht unvorstellbar und so etwas gibt es auch nicht. Denn was passiert da? Bei Beethoven, einem Komponisten an der Schwelle des 18. und 19. Jhd., ist die ganze Macht von Traditionen mit den in ihr herrschenden Gattungsnormen noch präsent, die für ihn ein verpflichtendes Erbe bedeuten. Welcher Affekt wo ausgedrückt werden darf, ist durch die Konvention streng geregelt. Dantes „Göttliche Komödie“ heißt nicht so, weil es dort um den Bericht von komödiantisch-lustigen Dingen ginge. Die Darstellung der Hölle ist beileibe nicht lustig! Nein, es geht in der Komödie um die „kleinen“ Dinge, die gemeinen Laster des alltäglichen Lebens und entsprechend die „kleinen“ und kleinlichen Gefühle wie Eifersucht und auch Wut und Zorn. Der Ausdruck der „großen“ Gefühle dagegen gehört nicht in diese niedere Gattung, sie sind der eigentlich erhabenen Gattung, der Tragödie, vorbehalten, in der entsprechend auch die Eifersuchtskomödien nichts zu suchen haben. (Heiligen Zorn kann es in der Tragödie freilich geben, aber nicht einen banalen Wutausbruch!) Mit der Gattungsnorm vereinbar ist bei Beethoven noch, dass die Wut in einem Charakterstück wie der „Wut über den verlorenen Groschen“ vorkommt, aber in einer großen Klaviersonate und zudem noch einer Fuge, die in ihrer Strenge so etwas wie eine erhabene Kathedrale darstellt, hat sie im Grunde nichts zu suchen. Wenn Kaiser von dem eigentlich unmöglichen „klassischen Ausgleich der Waldstein-Spannungen“ spricht, dann hilft es hier, an diesen Wutausbruch zu denken, der in der Hammerklaviersonate in die große Fuge hereinplatzt: Beethoven, der Freigeist, bringt hier die Gattungsnormen gehörig durcheinander und schafft damit ein Neues, was nicht nur irritiert, sondern zu Spannungen, Widerstreiten bis hin zu Widersprüchen im Aufbau der Komposition führt. Beethoven, so zeigt sich damit, ist ein Klassiker freilich, aber kein glatter Klassizist. Der Wutausbruch ist im Grunde ein Fremdkörper, ein nicht zu integrierendes Element, das aber – und hier kommt Beethovens klassisches Formgefühl ins Spiel – doch irgendwie in die Form integriert werden soll: Beethoven versucht damit das Unmögliche um nicht zu sagen Absurde, das Unharmonische zu harmonisieren. Und genau da liegt die bis zur Überforderung gehende Herausforderung des Interpreten, das auch dem Hörer vorzuführen, dass es gelingt und wie es gelingt – wenn er eben diese Interpretationsaufgabe auch wirklich begreift und sich nicht nur mit einem Sicherheit vortäuschenden Intuitionismus an solchen Interpretationsfragen vorbeimogelt.
Es gibt dafür noch ein anderes Beispiel – und das ist der mich auch persönlich immer wieder irritierende Schluss von Beethovens vorletzter Klaviersonate op. 110. Auch da kulminiert der Satz in einer Fuge. Doch dann passiert wiederum etwas Unglaubliches. Die Fuge wird in einer Art dynamischem Orkan zum Schluss einfach weggeblasen. Man meint, der Freigeist Beethoven fühlt sich bei der Fugenstrenge, die er sich zunächst selbst auferlegt, wie in einem goldenen Käfig, dessen Gitter er schließlich mit seiner ganzen Willensenergie einfach ungeduldig geworden wegsprengt, wie wenn er sagen wollte: „So, nun habe ich mich lange genug mit dieser Fuge gequält und sie hängt mir zum Hals raus, also blase ich sie einfach weg!“ Bei kaum einem Interpreten gelingt hier eine überzeugende Lösung, dieses „Wegblasen“ der Fuge nicht einfach als ein abruptes Abbrechen und unmotiviertes Losbrechen eines Sturms erscheinen zu lassen, vielmehr dieses Ereignis in den Zusammenhang einer Fuge, die sich gleichsam von innen her auflöst, zu stellen. Gerade auch die Waldsteinsonate enthält eine ganze Reihe solcher Widerstreite von Beethovens Versuchen, das Desintegrierende zu integrieren, was einmal mit der Dynamisierung der Form zu tun hat aber ebenso dem Versuch, sich in der Komposition auch der Satzfolge an einer „Idee“ zu orientieren. Das zeigt sich am deutlichsten beim irritierenden Introduzione-Satz, wenn man ihn in seinem Versuch, das Unmögliche zu vereinigen, denn wirklich begreift. Doch bevor wir darauf kommen, sei mir noch eine abschließende Bemerkung zum methodischen Vorgehen erlaubt:
Aus dem 18. Jahrhundert stammt die Unterscheidung des „Kenners“ vom „Liebhaber“ der Musik. Sie geht zurück auf die Kultur der sogenannten „Empfindsamkeit“ in der zweiten Hälfte des 18. Jhd. Im Unterschied zum Kenner, der kompositionstechnischen und musikästhetischen Sachverstand besitzt, ist der Liebhaber ein Dilettant, der sich der Musik vor allem durch Empfindung und Gefühl nähert. Musik soll ihm ein „Erlebnis“ verschaffen, dass ihn selbst bewegt und das er als sein ureigenes betrachtet. Die in dieser Zeit entstehende Musikästhetik ist übrigens von eben dieser Empfindsamkeit geprägt vornehmlich eine sensualistische Rezeptionsästhetik – wie die vom absoluten Dilettanten in Sachen Musik Immanuel Kant oder auch dem bekennenden Musik-Dilettanten G.W.F. Hegel. Eduard Hanslick in seinem Feldzug gegen das, was er die „verrottete Gefühlsästhetik“ nennt, wird dann die Behandlung der Liebhaber-Empfindsamkeit aus der Ästhetik verbannen und in die Psychologie wegschicken und den Sachverstand des Kenners für den allein ästhetisch relevanten erklären. Doch abgesehen davon: Als ganz große Schwäche der Empfindsamkeit zeigt sich immer wieder, dass der Zugang über das „Gefühl“ das musikalische Erleben privatisiert. Der empfindsame Hörer betrachtet seine von der Musik ausgelösten Empfindungen als einen Privatbesitz, den er vor allem gegenüber dem Sachverständigen hütet wie die Henne ihre Küken vor einem Raubtier. Für den Sachverständigen gibt es eine „Wahrheit“, ein richtig und falsch in der Beachtung und Missachtung kompositionstechnischer und ästhetischer Regeln. Beim empfindsamen Hörer wird das Bemühen um Allgemeinverbindlichkeit, das für den Kenner unerlässlich ist, nun durch die privative Erlebnis-Authentizität nicht nur ersetzt, sondern auch bestritten. Und darin liegt ein beachtliches Konfliktpotential. Der Empfindsame empfindet den kennerhaften „Wahrheits“-Anspruch als Zumutung, weil er die Exklusivität seines Empfindens und damit letztlich ihn selbst in seiner Souveränität eines ausschließlich sich selbst gehörenden Erlebnis-Subjekts in Frage stellt. Das Authentizitäts-Erlebnis in seiner Exklusivität der Ich-Zugehörigkeit ist individuell und unvertretbar und lässt sich deshalb auch nicht in die Allgemeinverbindlichkeit eines Urteils über „wahr“ und „falsch“ überführen. Entsprechend duldet der Liebhaber und Dilettant keine „Belehrungen“ durch den Kenner, sondern betrachtet sie als arrogant und herablassend, weil sie ihm den Exklusivbesitz seiner „Erlebnis“-Evidenz, das, was sich nur durch die Erlebnis-Authentizität für ihn selbst ausweisen lässt, streitig macht. Deshalb gehört für ihn die Analyse und der Wahrheitsanspruch des Kenners möglichst weit weggesperrt in die geschlossene Anstalt von Meisterklassen für angehende Pianisten und von musikwissenschaftlichen Seminaren. Der Kenner wiederum wird geneigt sein, diesen Authentizitätswahn des Liebhabers als eine narzistische Eitelkeit zu betrachten, sich in die Subjektivität seines Selbsterlebnisses gleichsam zu vernarren und so dem Bemühen um Allgemeinverbindlichkeit eines ästhetischen Urteils erfolgreich aus dem Weg zu gehen. Wer die exklusive Intimitätssphäre des Subjektiv-Beliebigen partout nicht verlassen will, scheut den Gang in die Öffentlichkeit, welche kein Pardon für das Privativ-Private kennt, nicht zuletzt wegen der damit verbundenen Verlusterfahrung und dem Schmerz, dass sich alles Eitel-Subjektive in ein Objektives, alles Individuelle in ein Allgemeines notwendig verwandeln muss und also vor dem Licht der Wahrheit, ihrem Zwang und ihrer Verpflichtung zu einer begründeten und nicht einfach unbegründeten Meinung, keinen Bestand hat. Der Liebhaber und Dilettant stellt sich so letztlich auch nicht dem selbstgesetzten Anspruch Beethovens, der mit Blick auf den von ihm so geschätzten Adolph Bernhard Marx davon spricht, das „Höhere und Wahre“ in der Kunst erreichen zu wollen. Deshalb möchte ich noch einmal betonen, wie und wie nicht hier ein Interpretationsvergleich versucht wird:
Ich habe meine Ausführungen ganz bewusst einen „Dialog über Grundprobleme der Beethoven-Interpretation mit den Interpreten“ genannt, weil sie ausdrücklich nicht für den Liebhaber und Dilettanten vornehmlich bestimmt sind, der Musik nur passiv rezipieren will, sie deshalb für diesen auch nicht zur Diskussion gestellt. Meine Betrachtungen und Analysen geschehen vom Interpretations-Gesichtspunkt eines Spielers aus. Ich analysiere die Beethoven-Sonate so, wie ich es tun würde, wollte und müsste ich sie jetzt selber spielen. Im Unterschied zum Liebhaber beschränkt sich meine Analyse des Notentextes deshalb auch nicht auf das, was sich in den Grenzen des Gefühlserlebnisses vornehmlich erschließen lässt: Tempo und Dynamik. Gleichwohl unterscheidet sie sich durch ihren praktischen Bezug der Spielbarkeit ebenso von der Arbeit des Musikwissenschaftlers. Anders als beim Musikwissenschaftler ist die „Analyse“ des Spielers von einem pragmatischen Vermittlungsinteresse geleitet, was den Anspruch der Analyse deutlich zurückschraubt: Der Spieler muss sein Wissen eines Kenners in musiktechnischen und ästhetischen Fragen vermitteln mit seinem eigenen Erlebnis von Musik, indem er beide wiederum seinem Zuhörer und dessen Erlebnisperspektive vermittelt. Nur so viel Wissen ist nötig, wie es das eigene Erleben verstehbar und vermittelbar macht und umgekehrt dient die eigene Erfahrung von Musik dazu, das Wissen im Konkreten einer Interpretation zu erproben. Im Spieler vereinigt sich also der Zugang des Kenners mit dem des Liebhabers der Musik. So allerdings wird ein solcher Zugang für den Musikwissenschaftler eine höhere Form von Liebhaberei und Dilettantismus und für den reinen Liebhaber wiederum eine Zumutung bleiben. Doch genau darin liegt die Herausforderung solcher Analysen – eben letztlich auch eine Aufgabe der Vermittlung und ein Angebot bieten zu können für den, der sie sich freilich zumuten möchte.