
„Der wahrscheinlich bedeutendste Komponist der heutigen amerikanischen Musiklandschaft.“ („Musical Courier“, 1933)
Henry Kimball Hadley, geboren am 20. Dezember 1871 in Somerville, Massachusetts, gestorben am 6. September 1937 in New York City, war ein US-amerikanischer Komponist und Dirigent.
Hadley wurde in eine musikalische Familie hineingeboren: Sein Vater Samuel Henry Hadley (1844-1915) war Musiklehrer in Somerville, seine Mutter Martha T. Hadley (1847-1943) Sängerin und Pianistin und sein Bruder Arthur D. Hadley (1875-1936) brachte es zum Cellisten im San Francisco Symphony und später im Boston Symphony Orchestra. Seine ersten musikalischen Lektionen erhielt er folgerichtig vom eigenen Vater. Bereits im Alter von gerade 17 Jahren komponierte Hadley die Operette „Happy Jack“. Ein Jahr darauf, am 9. Dezember 1889, wurde ein Konzert mit Hadleys Kompositionen in der Franklin Church in Somverville gegeben.
Sein musikalisches Talent war unverkennbar. Befeuert durch Freunde und wohlgesonnene Kritiker entschloss sich Hadley sodann zum professionellen Musikstudium. Violine studierte er unter Henry Heindl und Charles Allen, Harmonie unter Stephen A. Emery, Kontrapunkt und Komposition schließlich unter dem angesehenen Komponisten George Whitefield Chadwick, dessen Einfluss auf den jungen Hadley unverkennbar war. Bis zu seinem 21. Geburtstag hatte er ein Streichquartett und eine dramatische Ouvertüre für Orchester komponiert.
1893 ging Hadley mit der Mapleson Operatic Company als Violinist auf Tournee, doch verließ er diese, als Gerüchte von einem Bankrott der Gesellschaft die Runde machten. 1894 reiste er zwecks eines Studiums beim Brahms-Vertrauten Eusebius Mandyczewski nach Wien.
1896 wurde Hadley Musiklehrer an der St. Paul's Episcopal School for Boys in Garden City, Long Island. 1900 erfolgte sein Debüt als Dirigent im Waldorf-Astoria in New York. Zwischen 1904 und 1909 befand er sich häufig in Europa und studierte u. a. in München bei Ludwig Thuille. Hier kam Hadley in Berührung mit der seinerzeit neuen Musik von Reger, Mahler und Richard Strauss. Als erster Amerikaner überhaupt dirigierte er in Berlin, später auch in Warschau sowie am Stadttheater in Mainz.

Henry Hadley als junger Mann (um 1905)
1909 schließlich wurde er zum Musikdirektor des Seattle Symphony Orchestra berufen und wechselte 1911 in derselben Funktion zum neugegründeten San Francisco Symphony. Von diesem Posten trat er allerdings schon 1915 wieder zurück, um sich wieder hauptsächlich der Komposition zu widmen. In der Folgezeit trat er vornehmlich als Gastdirigent in Erscheinung, so beim Boston Symphony Orchestra (ab 1910, zuletzt 1935), beim London Symphony Orchestra (1924) und beim Concertgebouw-Orchester Amsterdam (1924). Weitere Konzertreisen führen Hadley nach Paris, Stockholm und Buenos Aires. Zwischen 1920 und 1927 amtierte er noch einmal als assoziierter Dirigent bei der New York Philharmonic Society. 1929 erfolgte auf seine Initiative hin die Gründung des Manhattan Symphony Orchestra, welches in jedes seiner Programme Werke amerikanischer Komponisten aufnehmen wollte. Er verblieb dortiger Chefdirigent bis 1932. 1930 gelangte er auf Einladung des New Symphony Orchestra of Tokyo bis nach Japan, wo er mit großem Erfolg eine Reihe von Konzerten leitete.
Henry Hadley dirigert Wagners „Tannhäuser“-Ouvertüre mit dem New York Philharmonic (1926)
1925 spielte Hadley einige akustische Aufnahmen für die Starr Piano Company ein, 1926 folgten elektrische Aufnahmen für Columbia. Er tat sich auch als Filmpionier hervor. So wurde er im selben Jahr von Warner Bros. eingeladen, den Soundtrack für den Film „Don Juan“ mit John Barrymore zu dirigieren. Es handelte sich dabei um den ersten Film mit synchronisierter Orchestermusik. Ebenfalls 1926 entstand ein Tonfilm, in welchem Hadley das New York Philharmonic in einer (gekürzten) Darbietung der „Tannhäuser“-Ouvertüre von Wagner leitet. Es dürfte sich dabei um den ersten Tonfilm eines klassischen Werkes überhaupt handeln.
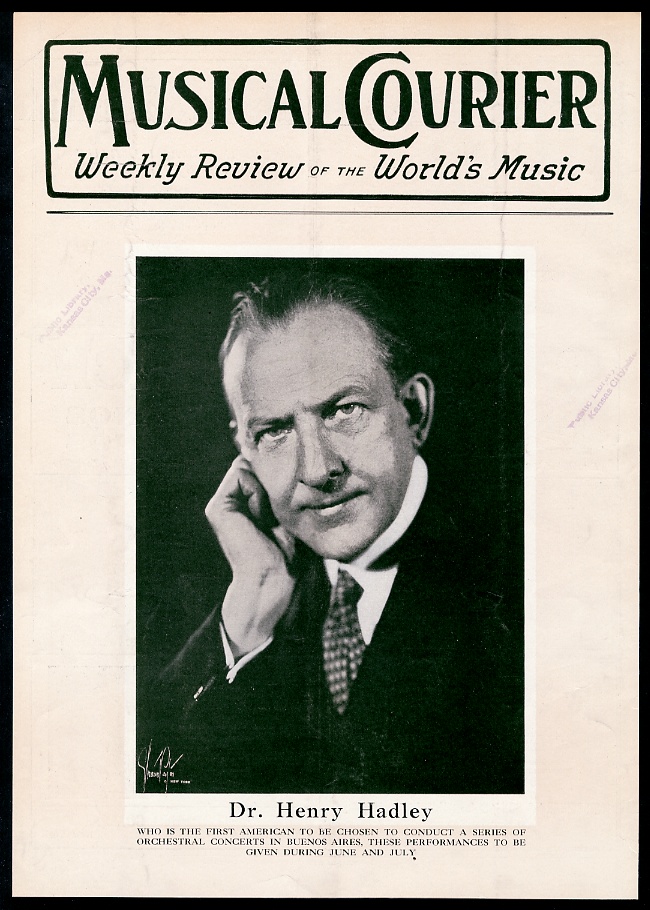
Henry Hadley auf dem Cover des „Musical Courier“ (1927)
Hadley gehörte zu den meistgespielten und verlegten amerikanischen Komponisten seiner Zeit. Er selbst sah sich in erster Linie als Komponist und war in beinahe jedem musikalischen Genre tätig. Sein Œuvre ist dementsprechend groß und umfasst Opern, Operetten, Bühnenmusik, Symphonien, Tondichtungen, Ouvertüren, Orchestersuiten, Konzerte, Oratorien, Kantaten und Kammermusik.
Zu Lebzeiten war Hadley enorm populär und fest verankert im Repertoire der amerikanischen Spitzenorchester, wurde aber auch in Europa gespielt. Zahlreiche bedeutende Dirigenten wie Gustav Mahler, Leopold Stokowski, Sergei Kussewizki und Karl Muck nahmen Hadleys Musik in ihre Konzertprogramme auf.
1934 wurde er zum Gründer des Berkshire Symphonic Festival, das als Tanglewood Music Festival später weltberühmt wurde. Seine vollständige postume Verdrängung aus der Historie dieses Sommerfestivals ist symptomatisch für den schlagartigen Rückgang seiner Popularität wenige Jahre nach seinem Ableben.

Henry Hadley in seinen letzten Lebensjahren
Seit 1932 an Lungenkrebs erkrankt, verstarb Henry Hadley am 6. September 1937 in New York an dessen Folgen kurz vor Vollendung seines 66. Lebensjahres. Seit dem 2. September 1918 war er mit der berühmten Konzertsängerin Inez Barbour (1885-1971) verheiratet gewesen. Sein Grab befindet sich auf dem Mt. Auburn Cemetery in Cambridge, Massachusetts.
Zu den zahlreichen Auszeichnungen, die Hadley verliehen wurden, gehörten die Mitgliedschaft im National Institute of Arts and Letters (1908) sowie in der American Academy of Arts and Letters (1924). Die französische Regierung machte ihn im selben Jahr zum Officier d'Académie. 1925 erhielt er vom Tufts College das Ehrendoktorat der Musik, 1930 einen weiteren Ehrendoktorgrad der Philadelphia Musical Academy.

Grabstätte der Familie Hadley
Werke (Auswahl):
Opern:
„Safié“ op. 63 (1909)
„Bianca“ op. 79 (um 1913)
„Azora, the Daughter of Montezuma“ op. 80 (um 1914)
„Cleopatra's Night“ op. 90 (1919)
„A Night in Old Paris“ o. op. (1924)
Symphonien:
Symphonie Nr. 1 d-Moll op. 25 „Youth and Life“ (1897)
Symphonie Nr. 2 f-Moll op. 30 „The Four Seasons“ (1899)
Symphonie Nr. 3 h-Moll op. 60 (1907)
Symphonie Nr. 4 d-Moll op. 64 „North, East, South, West“ (1910)
Symphonie Nr. 5 c-Moll op. 140 „Connecticut“ (1935)
Symphonische Dichtungen:
„Salome“ op. 55 (1906)
„The Culprit Fay“ op. 62 (1909)
„Lucifer“ op. 66 (1914)
„Othello“ op. 96 (1919)
„The Ocean“ op. 99 (1921)
Weitere Orchesterwerke:
„Herod“, Ouvertüre op. 31 (1901)
„In Bohemia“, Konzertouvertüre op. 28 (1902)
„Othello“, Ouvertüre op. 96 (1919)
„Streets of Pekin“ o. op. (1930)
„San Francisco“ op. 121 (1931)
„The Enchanted Castle“, Ouvertüre op. 117 (1933)
„Scherzo Diabolique“ op. 135 (1934)
Die ersten Stereoeinspielungen von Werken Hadleys entstanden in den 1960er Jahren mit dem Royal Philharmonic Orchestra unter Karl Krueger. Die von Krueger 1958 gegründete Society for the Preservation of the American Musical Heritage nahm sich vernachlässigter amerikanischer Komponisten an. Bridge Records legte die Aufnahmen der zweiten Symphonie sowie der Tondichtung „Salome“ 2003 auf CD neu auf (Bridge 9124A/C).
Wohl kein lebender Dirigent setzt sich in den letzten Jahren mehr für Henry Hadley ein als der Amerikaner John McLaughlin Williams (geb. 1957). Für das Label Naxos konnte er 1999 eine viel gelobte Einspielung der vierten Symphonie sowie der Tondichtungen „The Ocean“ und „The Culprit Fay“ vorlegen (Naxos 8.559064). Ursprünglich wollte er mit dem ihm zur Verfügung stehenden ukrainischen Orchester die fünfte Symphonie und die Tondichtung „Luficer“ aufnehmen, doch scheiterte dieses Vorhaben an der im Konzertsaal nicht vorhandenen Orgel. Seit gut zwei Jahrzehnten versucht McLaughlin Williams eine Ersteinspielung der fünf Symphonien und weiterer bisher nicht eingespielter Orchesterwerke vorzulegen, doch ließ sich bis dato kein Label von diesem kostspieligen Unterfangen überzeugen.
Immerhin scheint sich nun doch allmählich eine Trendwende anzubahnen. Das Label Dutton legte 2015 mit dem BBC Concert Orchestra unter Rebecca Miller eine CD mit Orchesterwerken Hadleys vor, darunter „Salome“ und die Ouvertüren „Othello“ und „The Enchanted Castle“ (Dutton CDLX 7319).
2011 konnte McLaughlin Williams „Lucifer“ mit dem Macon Symphony Orchestra doch noch aufführen. Die Besetzung erfordert u. a. vier Hörner, acht Trompeten, drei Posaunen, Tuba, Pauken, Schlagwerk, Orgel, Celesta und Harfe.
Anlässlich des anstehenden Jubiläums zum 150. Geburtstag des Komponisten plant das Seattle Symphony Orchestra unter seinem langjährigen Musikdirektor und nunmehrigen Ehrendirigenten Gerard Schwarz in der Spielzeit 2021/22 eine Aufführung der symphonischen Dichtung „The Ocean“ zur Eröffnung der neuen Benaroya Hall in Seattle.
Weiterführende Literatur und Informationen:
Canfield, John Clair, Jr., Henry Kimball Hadley: His Life and Works (1871-1937), Diss., Florida 1960.
https://henryhadley.com/index.html (Website zu Ehren des Komponisten)
https://henryhadley150.org/ (Website zum 150. Geburtstag des Komponisten)





