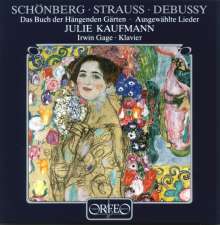Einleitende Anmerkungen:
Die Lieder von Schönbergs Opus 15 stellen einen Zyklus dar, der in der Tradition der großen Zyklen des Kunstliedes steht. Von seiner Thematik her, der musikalischen Ausleuchtung einer Liebesbeziehung und ihres Scheiterns, weist er eine deutliche Nähe zu Schuberts „Die schöne Müllerin“ und der „Winterreise“ auf, - allerdings mit einem markanten Unterschied, der in der jeweiligen poetischen Aussageabsicht Wilhelm Müllers und Stefan Georges gründet. Gibt es beim einen, bei Müller also, noch eine mehr oder weniger stark ausgeprägte, in der Einbindung der seelischen Innenwelt in die reale Außenwelt wurzelnde narrative Struktur, so stellen die Gedichte Georges eine radikale Reduktion der lyrischen Perspektive auf die Innenwelt des lyrischen Ichs dar, - ein Sachverhalt, der sich natürlich auch in der Liedmusik niederschlägt, - was aufzuzeigen sein wird.
Stefan Georges Gedichtzyklus liegt die einzige erotische Beziehung zugrunde, die er zu einer Frau hatte: Es war die 1870 in einer großbürgerlich-jüdischen Familie in Bingen geborene Ida Coblenz, die später die Frau von Richard Dehmel wurde. Sie begegneten sich 1892, und den Gartenbildern der Gedichte liegen die Erfahrungen zugrunde, die George im verwunschenen Garten der Familie Coblenz machte. Insgesamt handelt es sich um 31 Gedichte, aus denen Schönberg dann seine Auswahl für seine 15 Lieder traf. Sie entstanden – mit Ausnahme des letzten Liedes, das am 28.2.1909 komponiert wurde – alle im Verlauf des Jahres 1908 (die genauen Daten werden, soweit ermittelbar, bei der Besprechung der einzelnen Lieder angegeben). Die Erstaufführung fand am 14. Januar 1910 im „Ehrbar-Saal“ in Wien statt (Martha Winternitz-Dorda, Sopran; Etta Werndorf, Klavier).
Was Schönberg zur Lyrik Georges hinzog, darüber kann man nur Vermutungen anstellen. Vielleicht war es dessen aristokratische Vision vom Wesen der Kunst, die sich in einer stark ästhetisierten, stilistisch-formal stark durchgestalteten und gehobenen lyrischen Sprache niederschlug, der eine ganz spezifische Melange von Sinnlichkeit und auf Transzendenz ausgerichteter Sublimation eigen ist. Das Opus 15 ist ja nicht die erste kompositorische Auseinandersetzung mit Georges Lyrik. Schon zuvor (am 17.12.1907) hatte er ein Klavierlied auf eines von dessen Gedichten komponiert: „Ich darf nicht dankend“ (siehe Beitrag 27). Und in seinem zweiten Streichquartett op.10, das er kurz vor dem „Buch der hängenden Gärten“ in Angriff nahm und zeitlich parallel dazu weiter bearbeitete (vollendet in Gmunden, Juli 1908) sind in den beiden letzten Sätzen Texte aus dem 1907 erschienenen „Siebenten Ring“ rezitatorisch eingearbeitet.
Man darf also – ähnlich wie im Fall von Richard Dehmel - mit guten Gründen von einer besonderen Beziehung Schönbergs zur Lyrik Georges sprechen. Und es ist wohl in beiden Fällen das in der jeweiligen Lyrik sich artikulierende Lebensgefühl, deren Modernität also, die Schönberg dazu bewog, sich kompositorisch auf sie einzulassen. Theodor W. Adorno hat dies in der ihm eigenen dunkel-brillanten Diktion auf den Punkt gebracht:
„Die erstickende Luft von Georges babylonischem paradis artificiel ist der Brennstoff ihrer Moderne. So fremd wie seine literarische Interieurlandschaft sind die musikalischen Mittel gewählt; das Gepreßte, rauschhaft Schmerzliche des Innenraums, der seine Welt verloren hat, kehrt wieder in dem berückenden und angespannten Ton der Lieder.“.(1959).
Zur – vom Wiener „Verein für Kunst und Kultur“ organisierten - Uraufführung am 14. Januar 1910 merkte Schönberg an:
„Mit den Liedern nach George ist es mir zum ersten Mal gelungen, einem Ausdrucks- und Form-Ideal nahezukommen, das mir seit Jahren vorschwebt. Es zu verwirklichen, gebrach es mir bis dahin an Kraft und Sicherheit. Nun ich aber diese Bahn endgültig betreten habe, bin ich mir bewußt, alle Schranken einer vergangenen Ästhetik durchbrochen zu haben…“.
Was er mit dem „Durchbrechen“ der Schranken einer „vergangenen Ästhetik“ meint, ist das Verlassen des Prinzips der Tonalität, das bislang – bei all ihren Auslotungen der Grenzen tonaler Harmonik gegen Ende des Jahrhunderts - der Liedkomposition zugrundelag. Bei den Liedern des Opus 15 handelt sich also um eine im wesentlichen atonale Komposition. Diesen Begriff lehnte Schönberg freilich ab. Er schien ihm, genauso wie der Begriff „tonal“ „unrichtig gebraucht“. Er polemisierte regelrecht gegen die „Atonalisten“: „Davon muß ich mich jedoch abwenden, denn ich bin Musiker und habe mit Atonalem nichts zu tun. Atonal könnte bloß bezeichnen: etwas, was dem Wesen des Tones durchaus nicht entspricht.“ Im Hinblick auf seine, mit dem Opus 10 einsetzende, Weiterentwicklung seines kompositorischen Grundkonzepts sprach er vielmehr als von einer „Periode, die auf ein tonales Zentrum verzichtet, was man fälschlich >Atonalität< nennt.“
Der für das Verständnis der das Prinzip der Tonalität hinter sich lassenden musikalischen Schöpfungen Schönbergs – also, was die Klavierlieder betrifft, die „atonalen“ des Opus 15 und die dodekaphonischen des Opus 48 (auf die noch eingegangen wird) - maßgebliche Begriff ist „Emanzipation der Dissonanz“. Er hat ihn immer wieder als Schlüsselbegriff verwendet, - in dem Sinne, dass eine Musik, die nach diesem kompositorischen Konzept geschaffen ist, „die Auffaßbarkeit der Dissonanzen der Auffaßbarkeit der Konsonanzen gleichstellt.“ Alban Berg hat – ganz im Sinne Schönbergs - mehrfach betont, dass die „atonale“ Musik Schönbergs keine grundsätzliche Veränderung der Musiksprache sei, sondern eine Ausschöpfung des „unermeßlichen Reichtums“ der „durch die Musik von Jahrhunderten gegebenen kompositorischen Möglichkeiten. Er vertrat damit die Position seines Lehrers, der sich nicht genug darin tun konnte, sich als „Erbe der klassisch-romantischen Musik“ zu bezeichnen, und in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass bei „jedem bedeutenden Richtungswechsel in der Kunst schließlich immer das Neue vereint mit dem früheren da(steht)“.
Die Anbindung an das Erbe des romantischen Klavierliedes zeigt sich in diesem Opus 15 nicht nur darin, dass es sich - worauf Adorno hinwies - in die mit Beethovens „An die ferne Geliebte“ einsetzende Tradition der großen Liederzyklen stellt, sie dokumentiert sich auch darin, dass das kompositorische Konzept der Atonalität nicht radikal, im Sinne einer Prinzipienreiterei also, eingesetzt wird. Es finden sich in den Liedern immer wieder kurze tonal angelegte Passagen, wobei d-Moll, bzw. –Dur eine herausragende Rolle spielt, - wie man im achten Lied vernehmen kann, das gleichsam im Zentrum des Werkes steht.