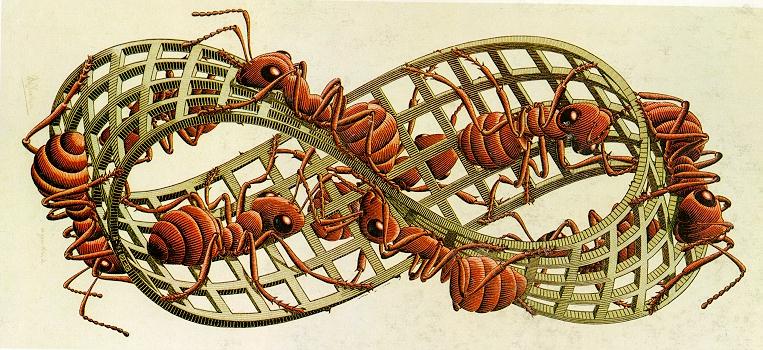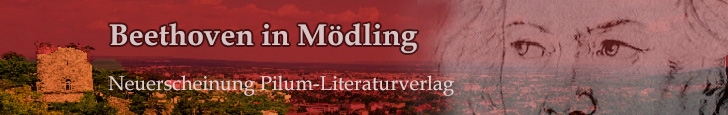Ich habe mir mittlerweile das längst nur noch antiquarisch erhältliche Buch „Musik aus dem Jenseits“ bei einer Bücherbörse besorgt. Glücklicherweise zu einem annehmbaren Preis (um die 10,- Euro) weil im Regelfall werden hier schon Liebhaberpreise aufgerufen. Ich wollte mir einen Eindruck davon machen was Rosemary Brown im Detail dazu schildert, da auch hier im Forum berechtigte Fragen aufgeworfen wurden und diese vielleicht im Buch teilweise erklärt werden können.
Sie selbst stellt es so dar, als wäre dieses ganze Projekt nie ihr eigener Wille gewesen, sondern eine Art sprituelle Berufung indem Franz Liszt sie aus dem Jenseits heraus kontaktierte und an eine ehemals getroffene Vereinbarung erinnerte. Er soll der Initator dieses Projekts gewesen sein und auch er war es der erst den Kontakt zu anderen bekannten Komponisten ermöglichte. Brown meint, auch wenn es sicher ein Privileg war mit diesen bekannten Komponisten zu arbeiten, war es unterm Strich eher eine Bürde. Nicht nur dass die Übermittlungen sich überwiegend als anstrengend erwiesen, so sei es nicht ihr Naturell sich permanent in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Zudem leidete sie darunter wenn sie teils als Spinnerin, teils als Betrügerin abgestempelt wurde. Angeblich konnte sie zwar von den Auftritten, LP- und Buchveröffentlichungen gut leben aber nicht reich damit werden. Soweit zumindest das was ihre eigene Darstellung anbelangt.
Nach meinem Eindruck den ich aus einer damals produzierten Reportage gewinnen konnte, habe ich eher das Gefühl dass es sich hier nicht um eine narzisstische Persönlichkeit handelt. Brown wirkt im Interview zurückhaltend, antwortet meist nur knapp und das notwendigste. Ihr Erscheinungsbild ist unprätentiös, bieder und schlicht. Die musikalischen Fähigkeiten sollen begrenzt gewesen sein, was Brown zufolge von Liszt beabsichtigt war, denn bei einem musikalischeren Medium hätte die Gefahr bestanden dass sich die Gedanken der Komponisten mit denen des Mediums durchmischen. Das würde zumindest auch einleuchten.
Für mich bleibt es auch vor allem aufgrund des hier schon öfter zu Recht aufgeworfenen Kritikpunkts
ZitatAlfred: „unter den überlieferten Werken gibt es KEIN EINZIGES, das ÜBERRAGEND wäre“
offen. Das bezeugt auch, dass kein einziges dieser Werke in Konzertprogrammen Einzug gefunden hat. Statt Brown etwa neue Klaviersonaten von Beethoven, Schubert oder Liszt veröffentlichte, was sicher zumindest eine viel nachdrücklichere Botschaft gewesen wäre, hat sie ausschließlich kleinere Klavierstücke, vergleichbar mit Schuberts Moments Musicaux oder Beethovens Bagatellen, herausgebracht (und selbst da hinken sie noch etwas hinterher). Das kann, muss aber nicht zwangsläufig eine Widerlegung sein. Theoretisch wäre die Übermittlung für größere Werke zu anstrengend für Brown gewesen, oder die Komponisten wollten mit Absicht ihre besseren Werke zumindest vorerst noch zurückhalten, weil sie fürchteten dass diese dann doch unter dem Namen „Rosemary Brown“ etikettiert werden.
ZitatAlfred „Interessanterweise (und geradezu entlarvend) ist das Fehlen von Werken von Mozart und Bach, sowie Haydn...Hat sie sich mit den Betreffenden nicht vertragen ? Oder wär hier eine Stilkopie zu verräterisch ?“
ZitatModerato „Wieso nur bestimmte Komponisten Rosemary Brown erschienen sind, dafür habe ich keine Antwort“.
Meiner Meinung nach macht es die Sache eher glaubwürdiger als zweifelhaft, wenn hier bestimmte große Namen fehlen (etwa auch Tschaikowsky, Mendelssohn oder Händel) Wenn es nämlich so war, wie Brown behauptet, dann ist davon auszugehen dass jeder der Komponisten weiterhin eine eigene Persönlichkeit und vielleicht auch eigene Ansichten zu diesem Projekt hat. Das darf man sich dann nicht wie willenlose Marionetten vorstellen die nur darauf warten einer englischen Hausfrau permanent Noten mitzuteilen. Und diejenigen die sich nicht beteiligt hatten (warum auch immer) wurden ja auch nicht eines Besseren belehrt. Das Projekt ist im Grunde genommen gescheitert. Skeptiker können diese kleinen Klavierstücke nicht überzeugen und diejenigen die es überzeugen konnte, sind auch schon ohne Brown von einem Leben im Jenseits überzeugt.
Hinsichtlich der Zusammenarbeit gibt es aber eine interessante Buchstelle
„Andere, wie Albert Schweitzer, kommen nur kurz, geben mir ein wenig Musik und kommen offenbar nicht wieder. Mozart, zum Beispiel, war nur dreimal hier“ (13)
Etwas später kann man im Buch wohl einen möglichen Grund erahnen.
„Meine erste Begegnung mit klassischer Musik hatte ich, als ich im Staatsdienst arbeitete. Eine meiner Bürokolleginnen war eine richtige Opernfanatikerin, und ich erinnere mich, daß sie eines Tages verzweifelt jemanden suchte, der mit ihr an diesem Abend ins Salders Wells gehen würde. Sie war eine sehr nette Person, und da sie nicht allein gehen wollte, nahm ich ihr die zweite Karte ab, nur um ihr eine Freude zu machen. Man gab Mozarts ‚Cosi fan tutte‘. Ehrlich gesagt, es gefiel mir nicht besonders. Ich fand die Oper recht amüsant, aber nicht besonders eindrucksvoll. Jedenfalls wurde ich nicht über Nacht zur Opernliebhaberin, und ich konnte einfach nicht verstehen, warum meine Kollegin so begeistert war. Aber selbst heute mag ich nicht jede Art von klassischer Musik. Poulence hat mich ein- oder zweimal besucht und unternommen, mir einige Musikstücke zu übermitteln, aber mir gefiel, ehrlich gesagt, diese Musik nicht, ich finde sie jedenfalls nicht attraktiv.“ (57 f)
Wegen der These des heimlichen Komplizen, da Brown in den 80ern wegen Herzprobleme und Arthritis die Arbeit eingestellt hat. Ausschließen kann man das natürlich nicht. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass Brown allmählich die Einsicht bekam, dass die kleinen Klavierstücke nicht ausreichen um die Skeptiker überzeugen zu können und da sie angeblich das Privatleben dem öffentlichen Leben um ein vielfaches vorzog, es dann auch damit belassen hat. Bei dieser These müsste aber Brown ein sehr gutes Gedächtnis haben, denn sie wurde ja auch schon vom Fernsehen live Tests unterzogen um spontan Werke mittels Übermittlung niederzuschreiben. Sie hat das erfolgreich bestanden was eine doch gute intellektuelle Leistung ist. Damit hätte aber Brown auch nur die etwas einfältig wirkende Hausfrau gespielt. Also das ganze ist schon ein Mysterium das viele Fragen aufwirft.
Fest steht und das bestreiten auch nicht die Kritiker: Die Stücke haben auffällig stilistische Merkmale zu den zu Lebzeiten verfassten Werken der jeweiligen Komponisten. Andererseits sind diese nur blasse Schatten von deren besseren Werken. Rosemary Brown macht bei ihrer Außendarstellung auch nicht den Eindruck einer besonders gerissenen, intellektuell bewanderten Frau. Entweder war sie somit selbst Marionette einer solchen Person, oder war eine exzellente Schauspielerin, oder konnte tatsächlich Kontakt mit verstorbenen Komponisten aufnehmen (womit dann noch immer das Rätsel um die Qualität offen bliebe) Möglicherweise werden wir es ja selbst im Jenseits erfahren. ![]()